Dieter R. Bauer Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
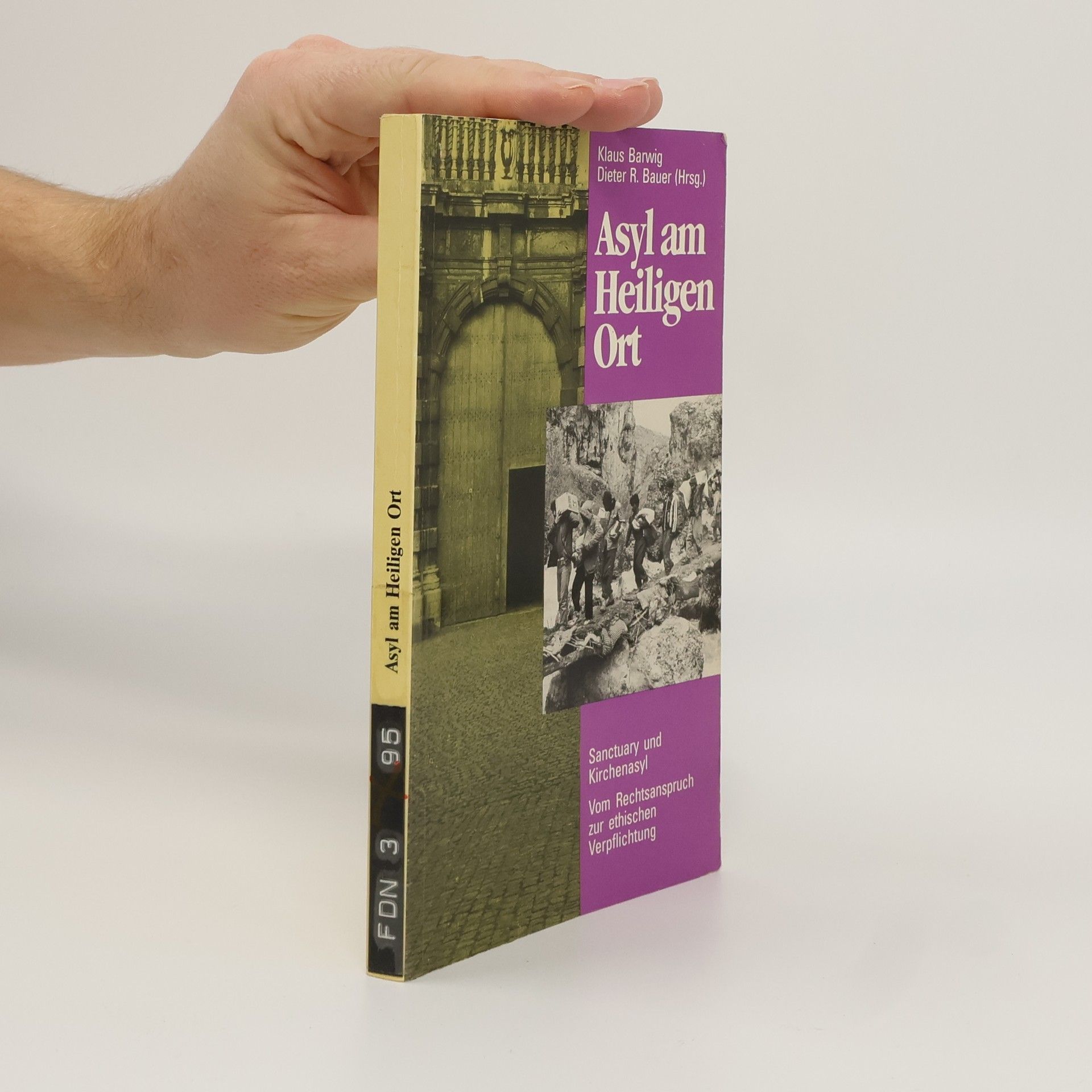
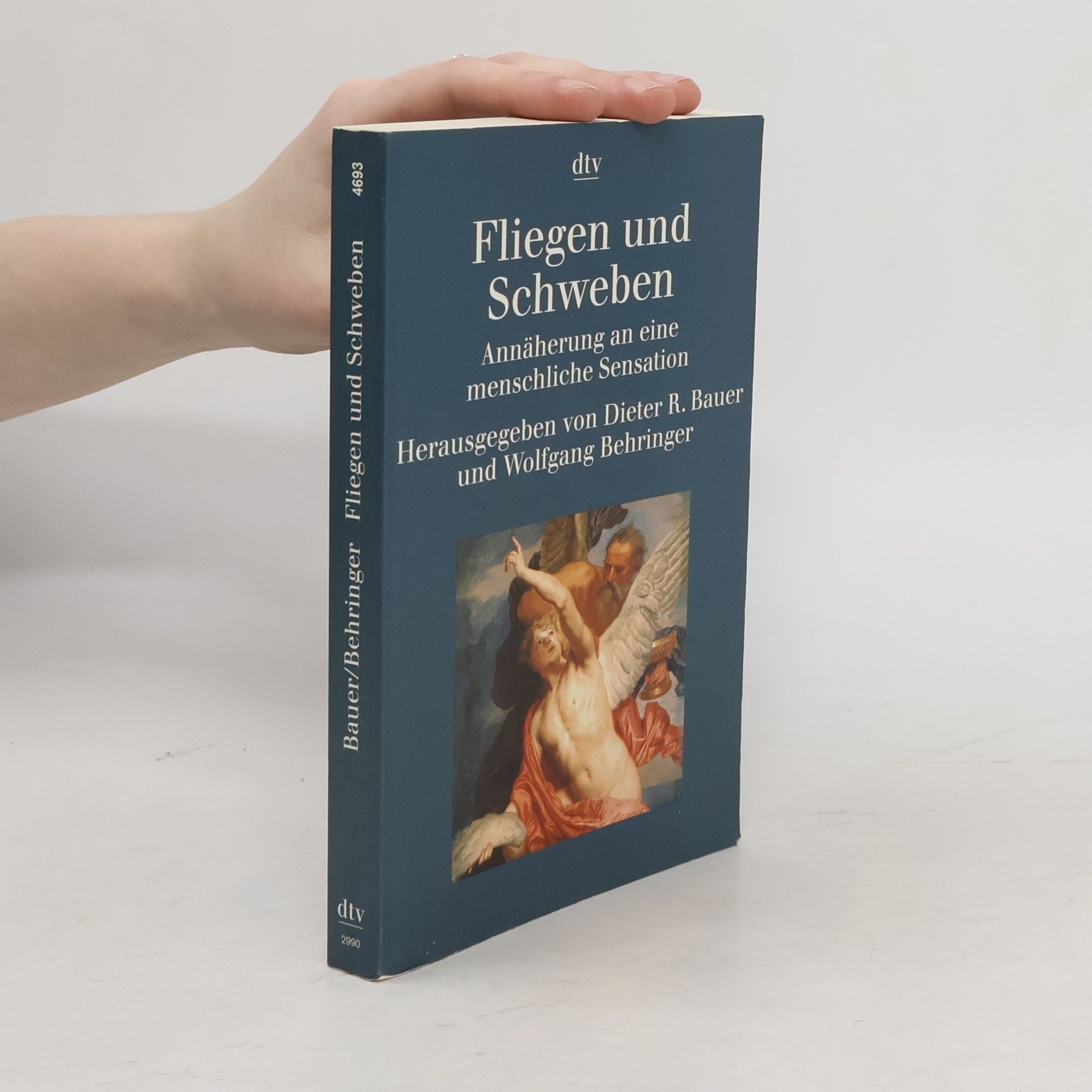
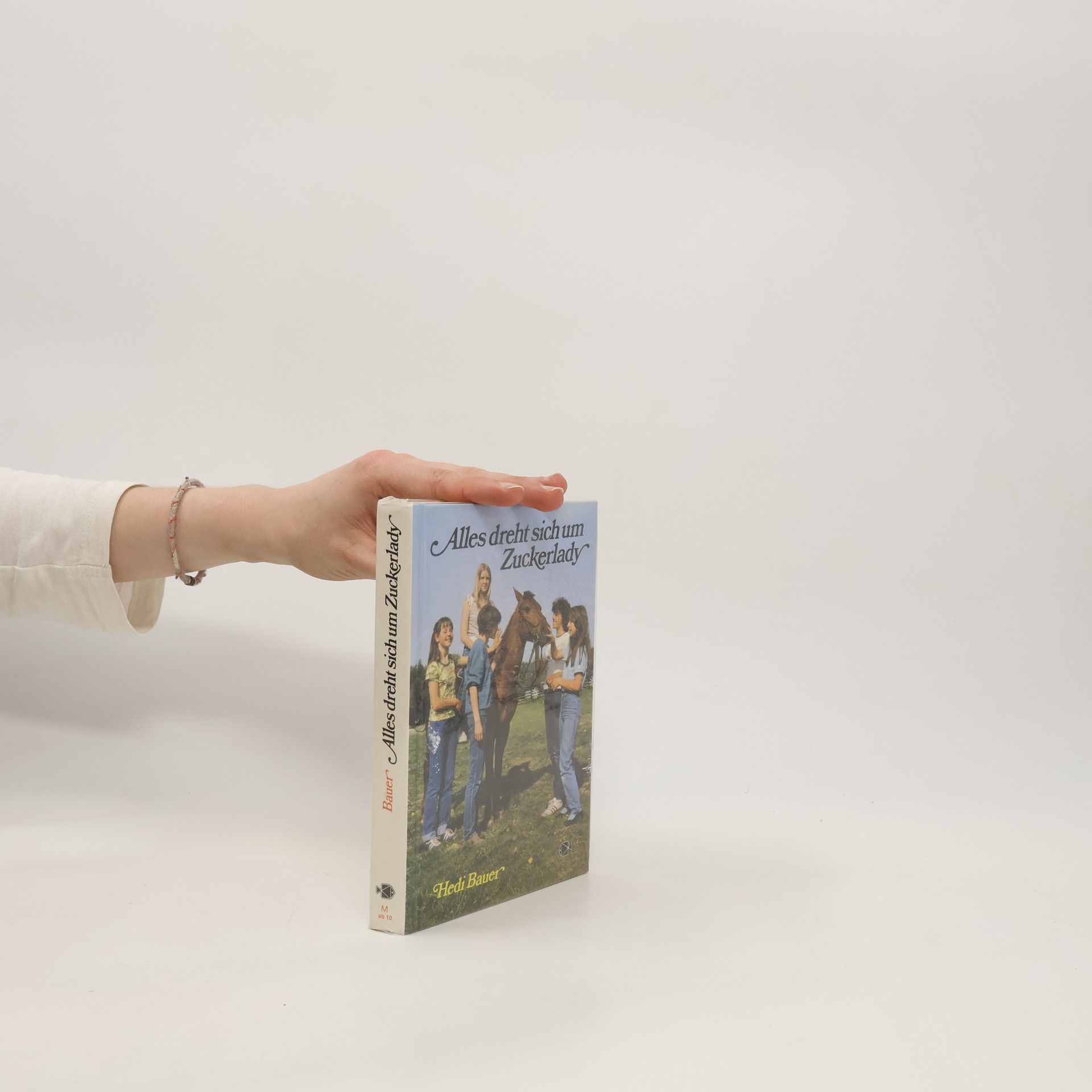
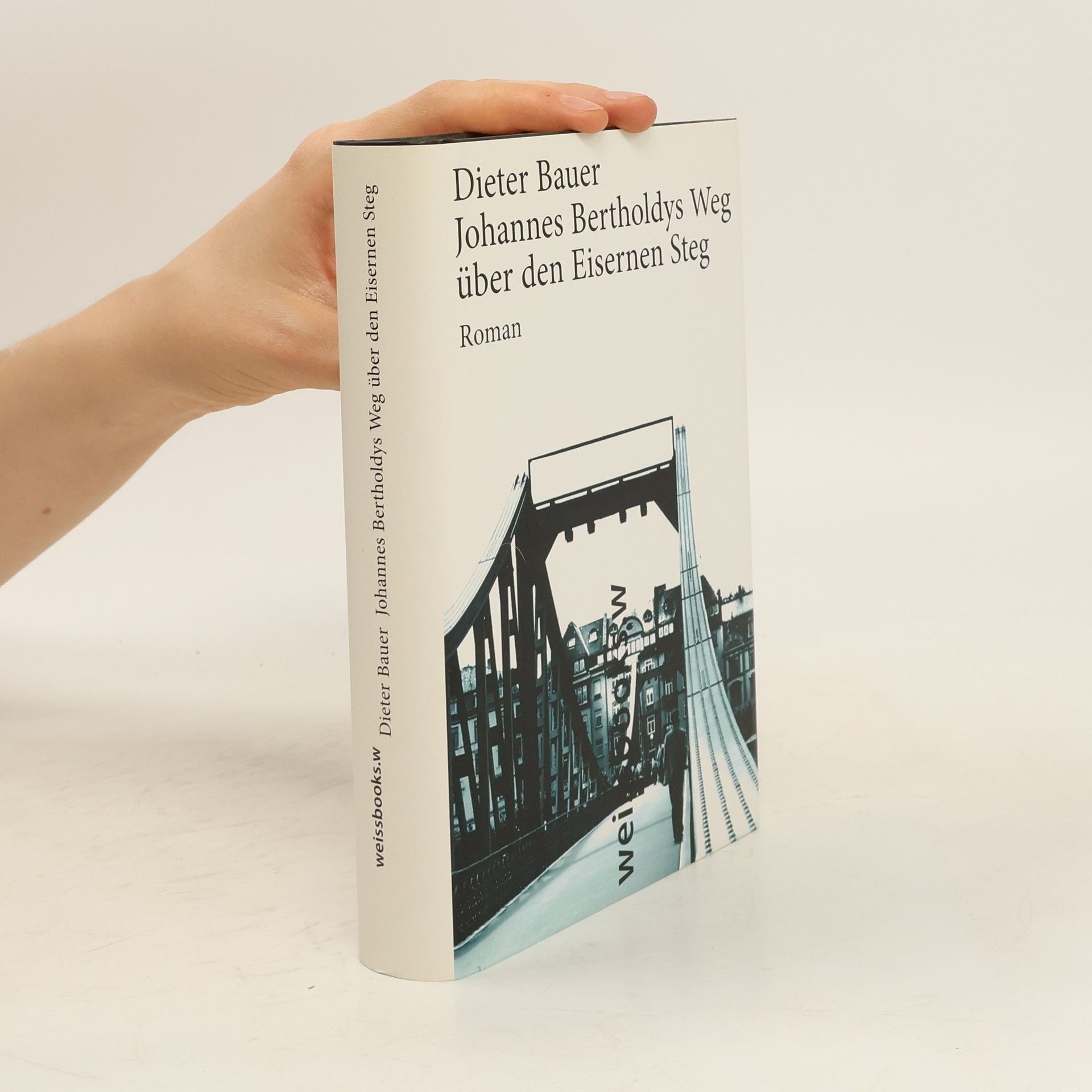
Fliegen und Schweben
- 406 Seiten
- 15 Lesestunden
Asyl am heiligen Ort
Sanctuary und Kirchenasyl: Vom Rechtsanspruch zur ethischen Verpflichtung
- 155 Seiten
- 6 Lesestunden
German
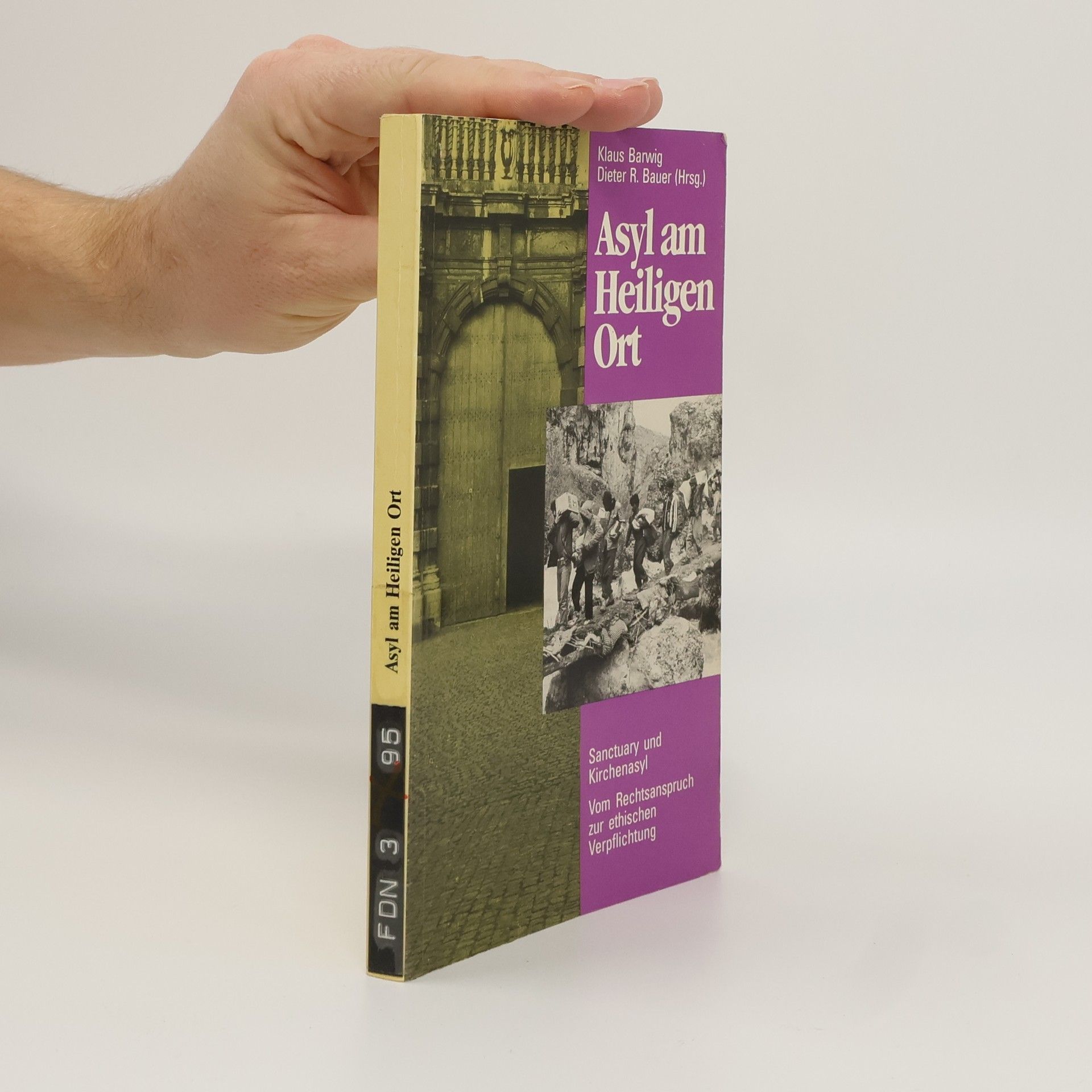
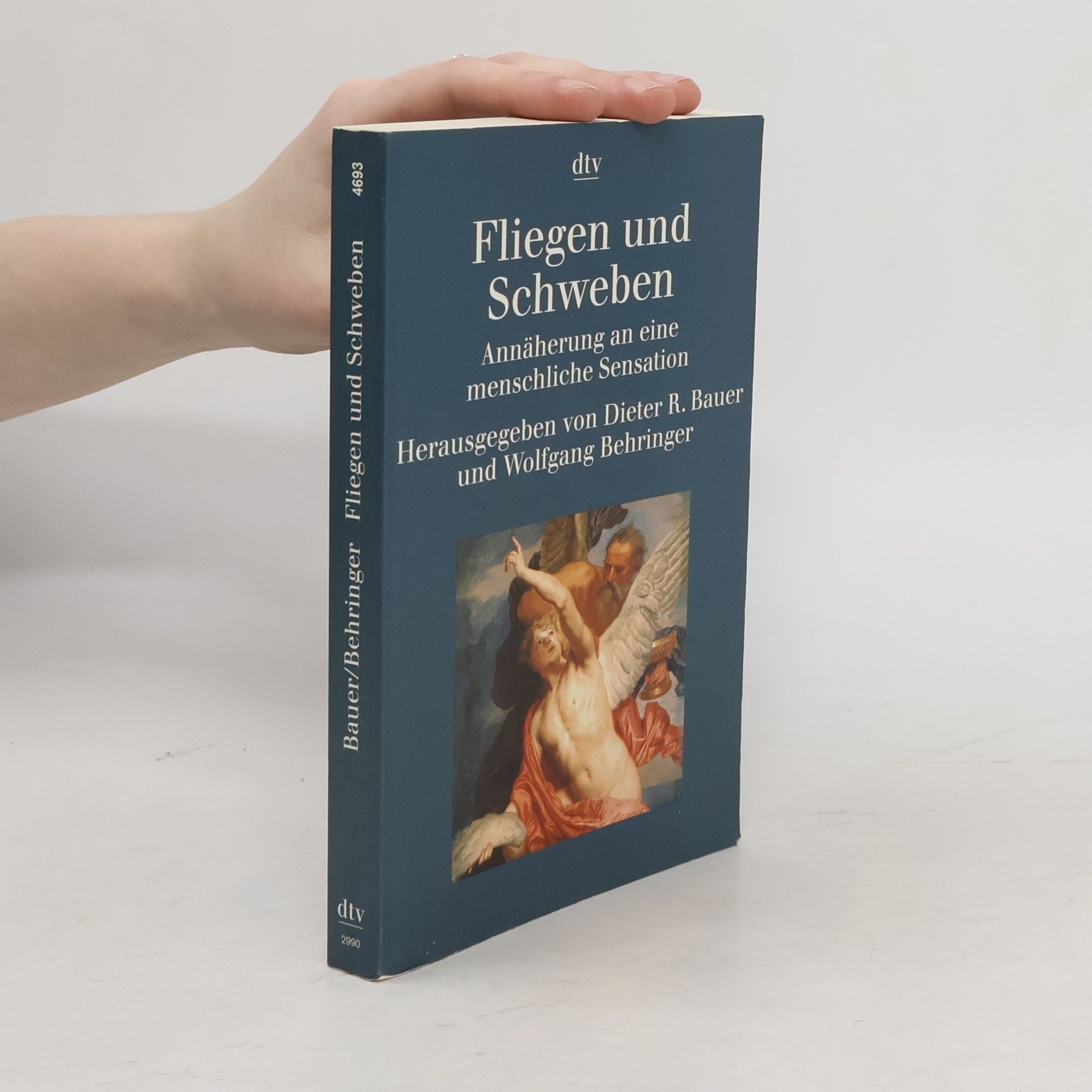
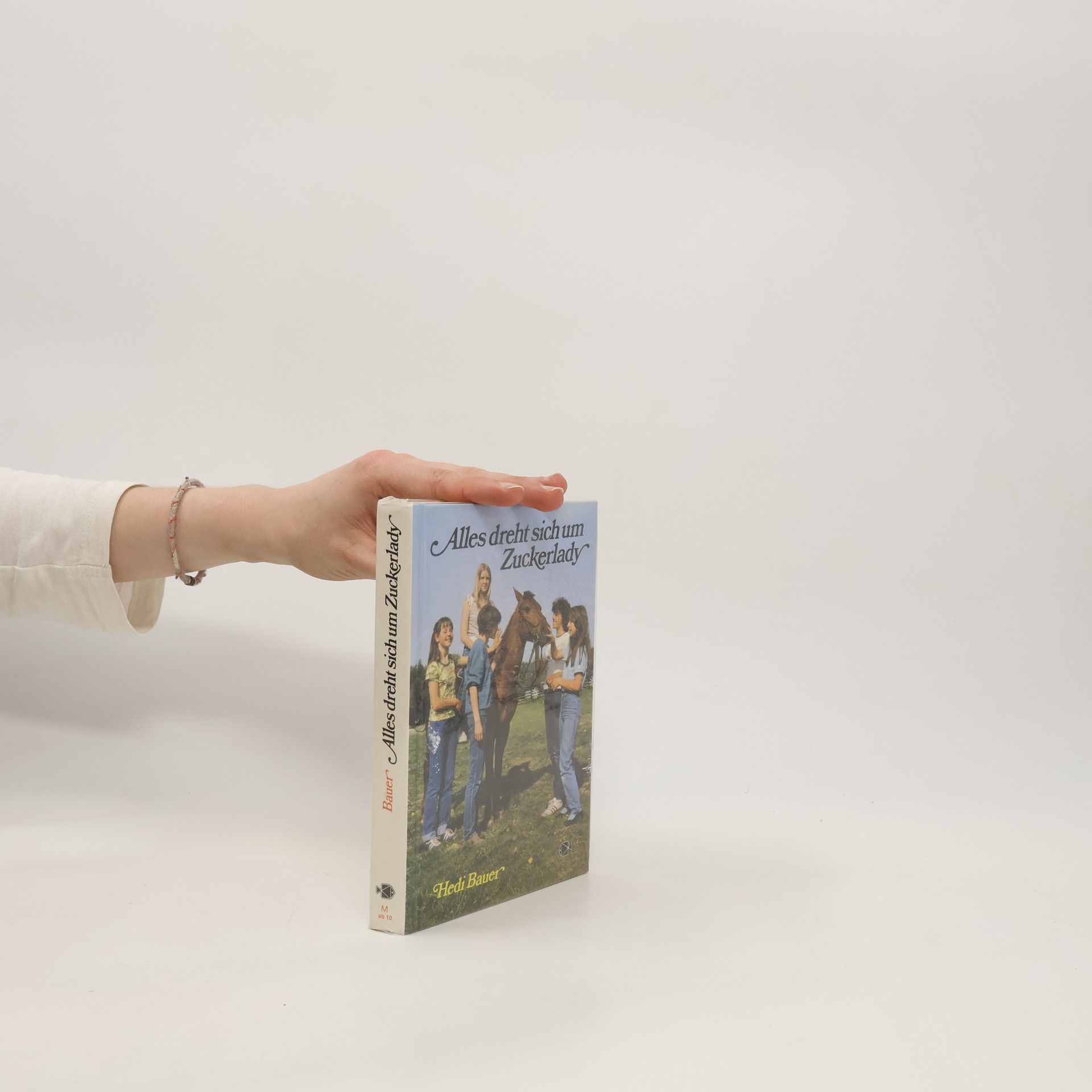
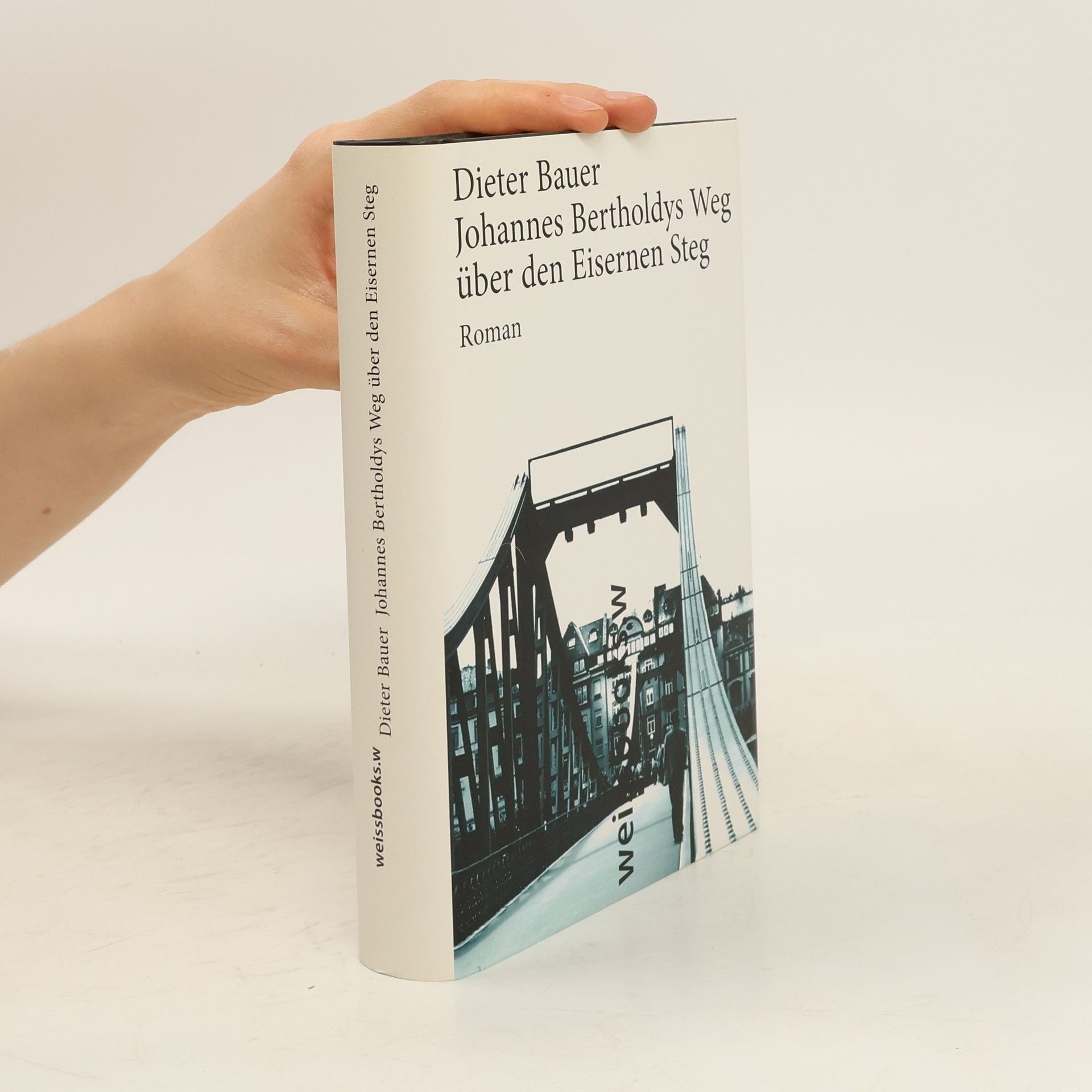
Sanctuary und Kirchenasyl: Vom Rechtsanspruch zur ethischen Verpflichtung
German