Reisen in der Antike
- 242 Seiten
- 9 Lesestunden



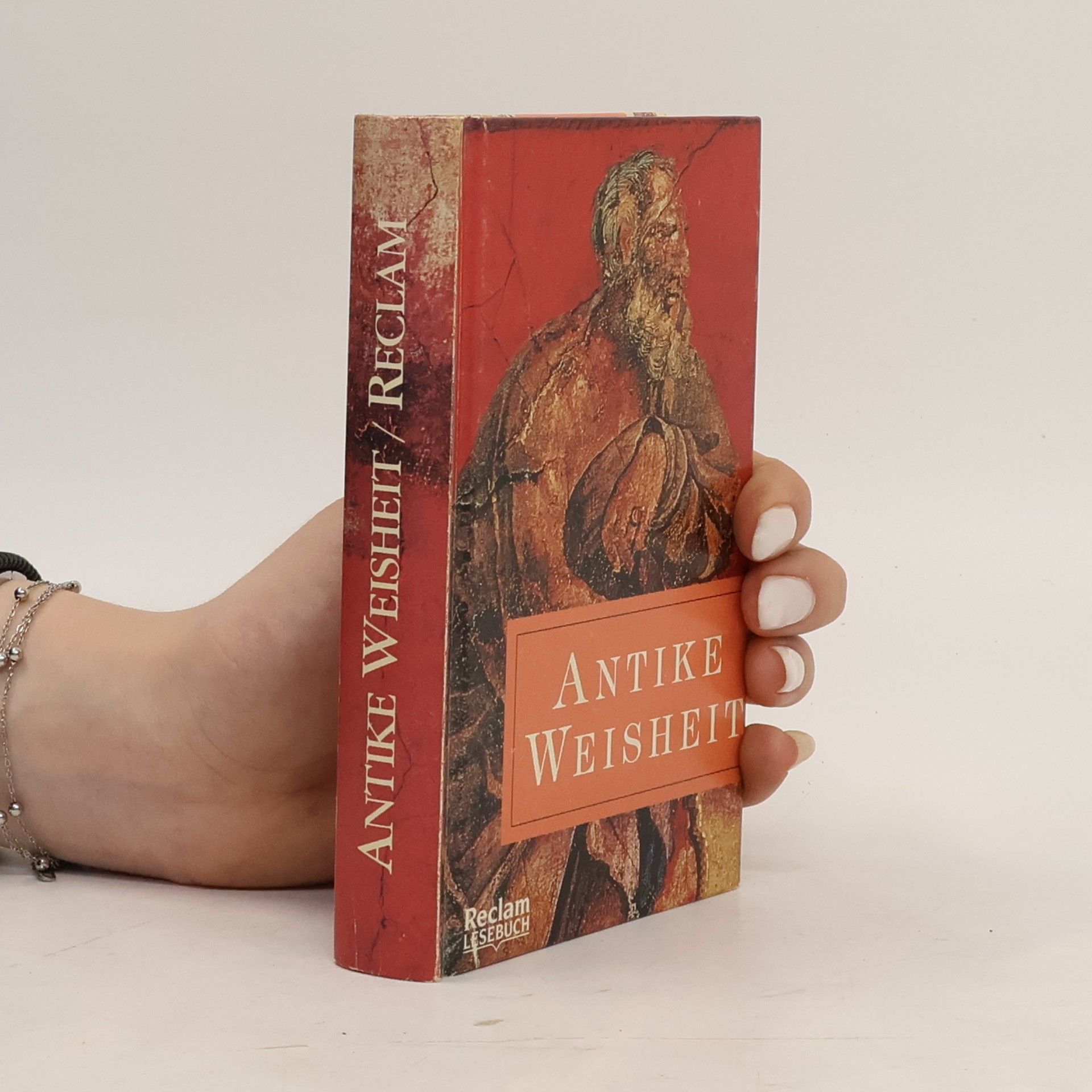

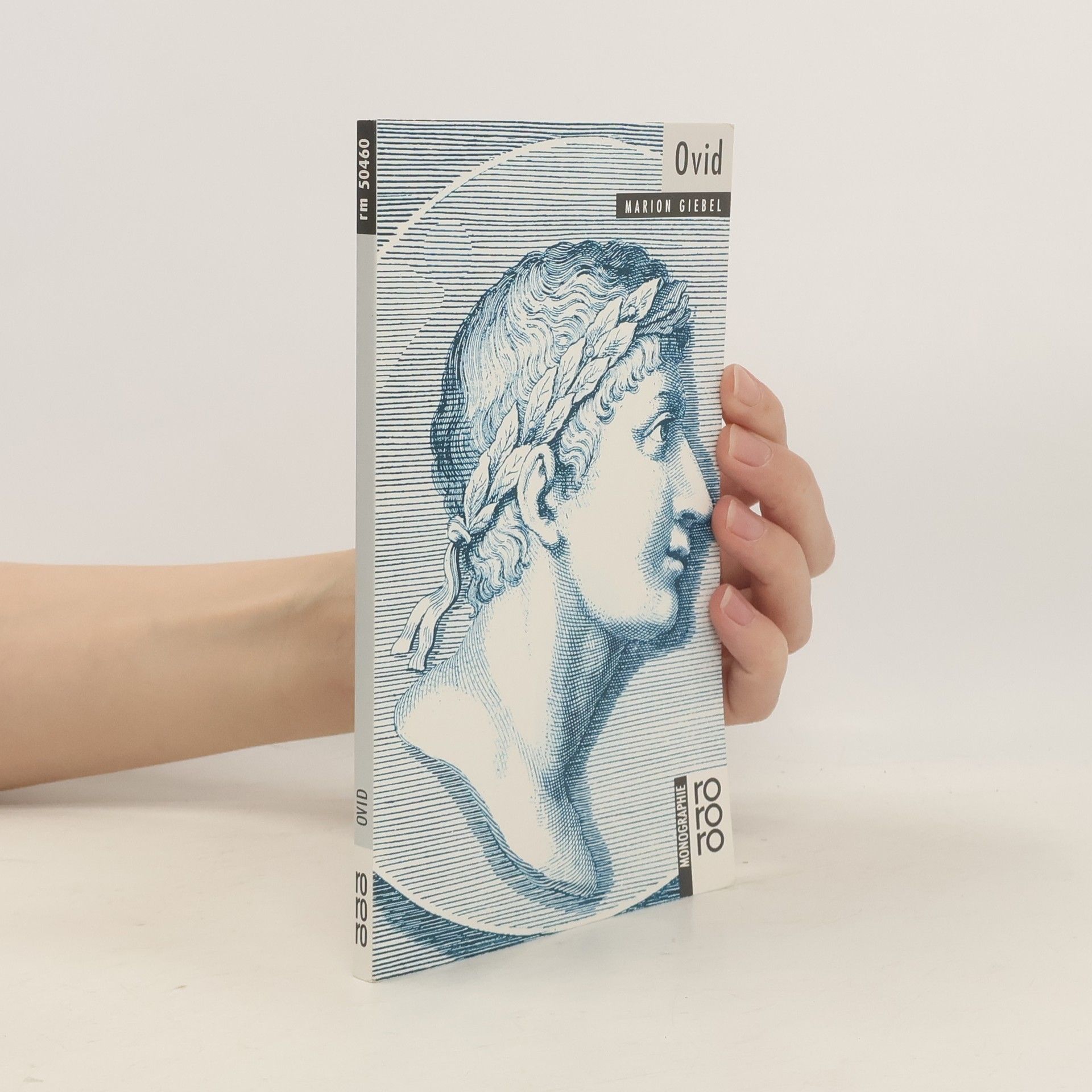

Ovid steht unserer Gegenwart so nahe wie kein anderer Dichter der Antike. Er trat mit seinen Büchern ein für den freien, partnerschaftlichen Umgang der Geschlechter und einem kultivierten Liebesgenuß. Und er schuf mit seinen „Metamorphosen“ den Hausschatz der antiken Mythologie: die Geschichten daraus werden bis heute in Literatur und Kunst immer neu gestaltet und gedeutet - wie die von Apollo und Daphne. Ovid geriet schließlich in Konflikt mit der konservativen Poltik des Kaisers Augustus und starb in der Verbannung.
Gaius Octavius, Caesar Octavianus, Augustus - drei verschiedene Namen führte der Mann, der 56 Jahre an der Spitze des römischen Reiches stand. Als Bürgerkriegsgeneral, Gefolgschaftsführer und Friedensfürst vollzog er die Wandlungen der Zeit exemplarisch an sich selbst. Als er mit 75 Jahren auf sein Leben zurückblickte, konnte er von sich sagen, er habe die Flammen der Bürgerkriege gelöscht, die Grenzen des Reiches ausgedehnt und dreimal den Janustempel geschlossen: zum Zeichen des Weltfriedens, der Pax Augusta. Dem Sohn einer Mittelstandsfamilie aus einer latinischen Kleinstadt war es nicht an der Wiege gesungen worden, daß er zum Herrn der Welt aufsteigen sollte.
Im Jahr 362 n. Chr. entbrennt in Antiochia ein Streit um Kaiser Julian Apostata und seinen Bart. Die Bewohner verspotten ihn mit Versen, doch Julian reagiert humorvoll und verfasst eine Selbstpersiflage, die als einzigartiges autobiografisches Zeugnis gilt.
Ein schlichter Grabspruch, den Vergil selbst verfaßt haben soll, faßt Leben und Werk des Dichters in knapper Form zusammen: Mantua gab mir das Leben, Calabrien raubt' es, Neapel birgt mich. Weiden besang, Felder und Helden mein Lied. Mantua in Oberitalien war seine Heimat, in Brundisium (damals Kalabrien) starb er am Fieber und wurde auf seinen Wunsch in Neapel, seinem langjährigen Wohnort, beigesetzt. Sein Schaffen umfaßte die Hirtengedichte (Bucolica oder Eklogen), das Lehrgedicht Georgica (Vom Landbau) und das Epos Aeneis. Am 15. Oktober 70 v. Chr., unter dem Konsulat des Crassus und Pompeius, ist Publius Vergilius Maro in Andes bei Mantua geboren. Seine Heimat gehörte damals zur Provinz Gallia cisalpina, dem diesseitigen Gallien (Oberitalien).
Monat für Monat – Überraschendes und Interessantes zu Menschen, Mythen und Natur aus der Antike Passend zum Jahreslauf begegnen wir jeweils kriegerischen Poeten, klugen Dichterinnen, zukunftsweisenden Herrschern oder dem Begründer einer bis heute gültigen Ärzteschule. Im Januar segeln wir auf dem winterlich-stürmischen Meer mit kühnen Poeten wie Archilochos; im Frühjahr lauschen wir dem Schwalbenlied zu Sapphos Fest auf Lesbos. Im Sommer reisen wir nach Rom, besuchen Cicero auf seinem Tusculanum und ziehen weiter zum Golf von Neapel, zum Hotspot Baiae, wo Seneca über den Luxus wettert und Nero seine Mutter zu einem verhängnisvollen Besuch einlädt. Im Herbst sind wir auf der Insel Kos und schauen zu, wie die Platane, unter der Hippokrates gelehrt hat, gegen die Winterstürme gesichert wird. Im Dezember feiern wir die Geburt Christi, ein Fest in der Nachfolge des Sonnengottes zur Wintersonnenwende. Und unsere Silvesterfeiern, mit fröhlichem Zusammensein, erinnern uns an die römischen Saturnalien im Dezember. Die „Populär-Philologin“ Marion Giebel erzählt Geschichten aus der Antike, eingebettet in ein ganz eigenes Naturverständnis im alten Griechenland oder Rom.
Lucius Annaeus Seneca wurde vor rund 2000 Jahren geboren. Als stoischer Philosoph, Tragödiendichter, Erzieher und Minister ist er eine der vielseitigsten Gestalten der Antike. Unter Kaiser Caligula verfolgt, unter Claudius verbannt und von Nero zum Selbstmord gezwungen, gab er der Nachwelt die Frage auf, ob und wie man philosophisches Denken und politisches Handeln vereinen kann. In seinen brillanten Essays weist er den Weg zur inneren Freiheit und Seelenruhe, zum «Leben gemäß der Natur», in Gemeinschaft mit den Menschen, die alle, auch die Sklaven, einen Funken des göttlichen Geistes in sich tragen.
InhaltsverzeichnisI. Kommentar, Wort- und Sacherklärungen II. Die griechische Tragödie und der Tragiker Sophokles III. Der Handlungsverlauf der „Antigone“ IV. Zur Wirkungsgeschichte und Rezeption in der Neuzeit V. Texte zur Diskussion VI. Literaturhinweise