Schriften zur Anthropologie
- 315 Seiten
- 12 Lesestunden
Max Scheler war ein deutscher phänomenologischer Philosoph, der für seine Arbeiten in den Bereichen Ethik und philosophische Anthropologie bekannt ist. Er entwickelte die phänomenologische Methode von Edmund Husserl weiter und wurde als eine der bedeutendsten philosophischen Kräfte seiner Zeit in Europa gefeiert. Schelers Schriften befassten sich mit einer breiten Palette von Themen, darunter Emotionen und Werte, und inspirierten nachfolgende Denkergenerationen. Sein Einfluss auf die Philosophie ist unbestreitbar und seine Ideen sind auch heute noch relevant.


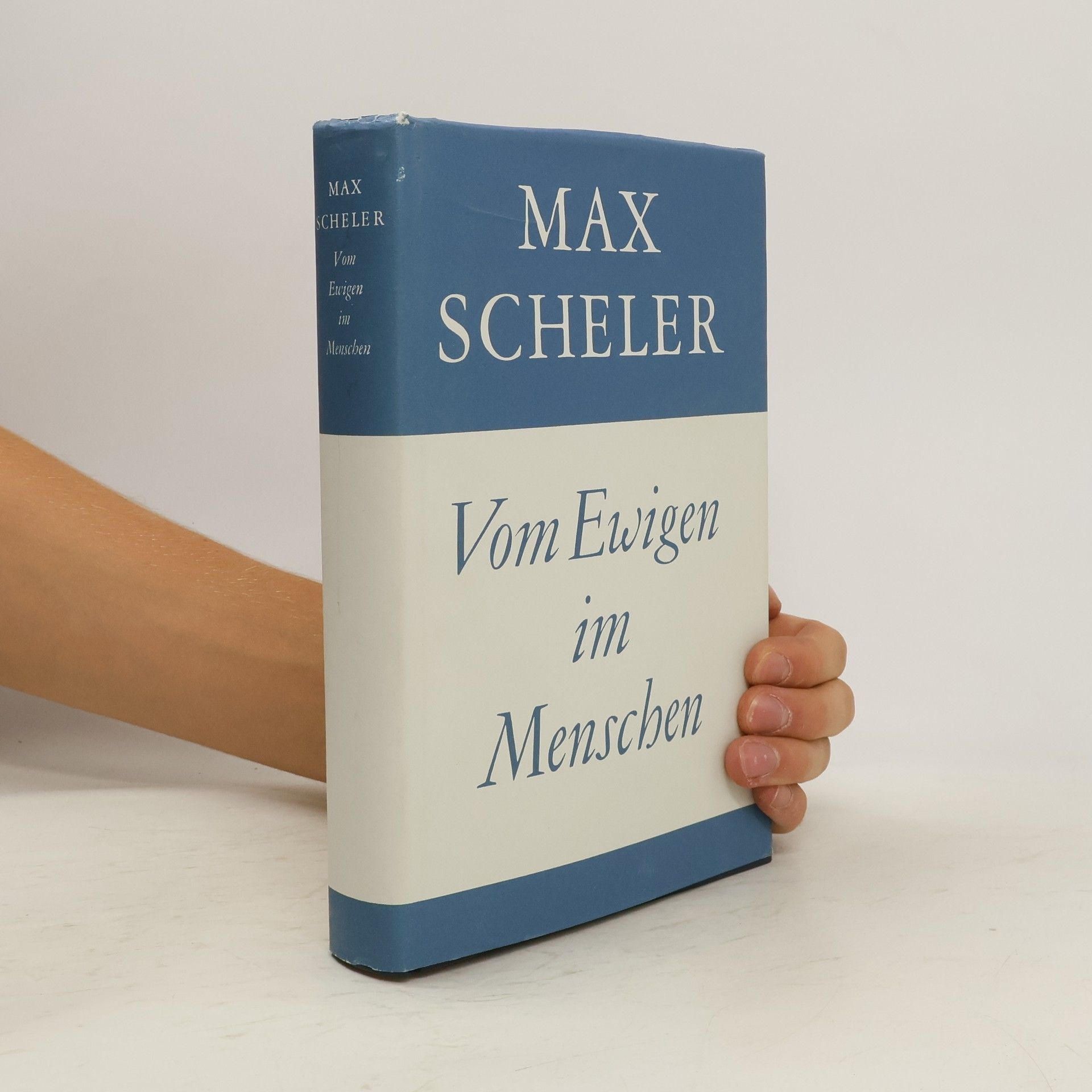

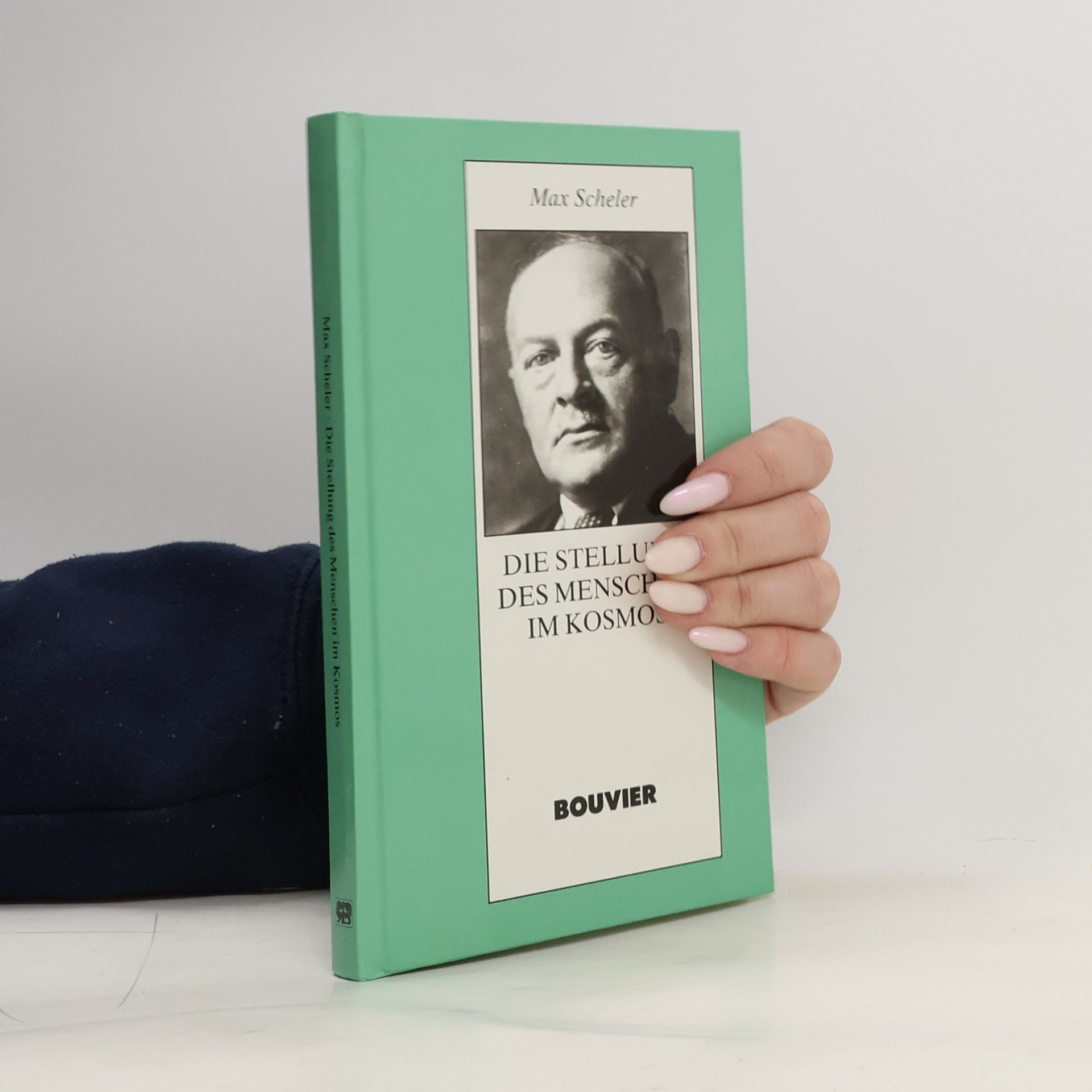

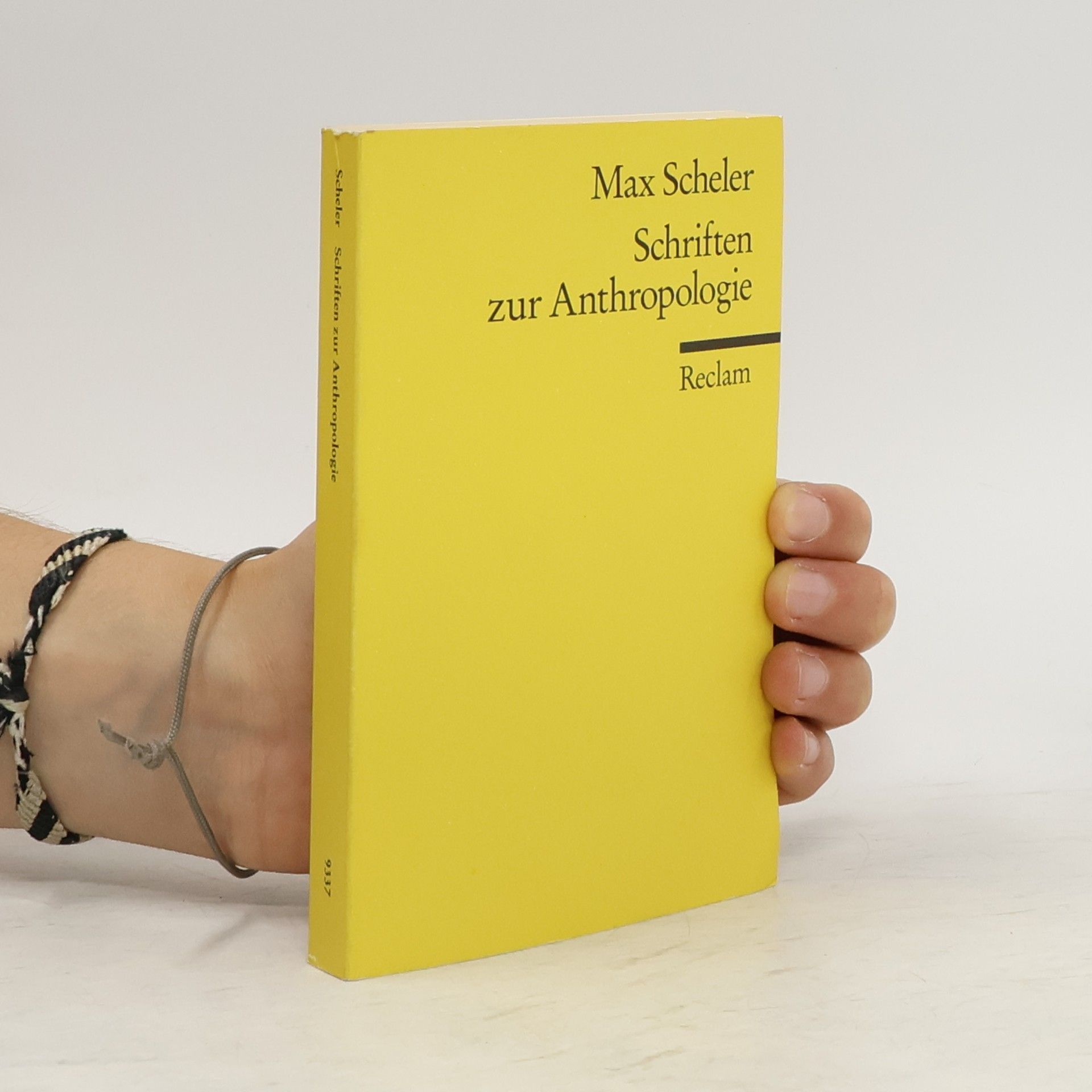
Scheler startet in diesem Buch einen Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Nachdruck des Originals von 1921.
Diesem äußerlich unscheinbaren aber geistesgeschichtlich wichtigen Büchlein liegt ein mehrstündiger mündlicher Vortrag zugrunde, den Max Scheler gegen Ende der 1920er-Jahre auf einer Konferenz gehalten hat.
Max Ferdinand Scheler (1874 - 1928), Philosoph, Anthropologe und Soziologe, bekannt für seine Ideen für eine grundlegende und umfassende "Philosophische Anthropologie", veröffentlichte 1915 die hier in zwei Bänden vorliegende Aufsatzsammlung zu allgemeinphilosophischen Fragen auf der Grundlage der von Scheler entwickelten "Wertethik". Nachdruck der Originalausgabe.
Das Werk, dessen erster Band hiermit der Offentlichkeit ubergeben wird, enthalt Abhandlungen und Studien, die im wesentlichen Problemen der Ethik und Religionsphilosophie gewidmet sind. Der Gesamttitel Vom Ewigen im Menschen soll andeuten, dass der Verfasser aufrichtig bemuht ist, seinen geistigen Blick zu erheben uber die Sturme und Gischte dieser Zeit - in eine reinere Atmosphare, und ihn zu richten auf das im Menschen, wodurch er Mensch ist, das heisst, wodurch er am Ewigen teil hat." Der Verlag der Wissenschaften verlegt historische Literatur bekannter und unbekannter wissenschaftlicher Autoren. Dem interessierten Leser werden so teilweise langst nicht mehr verlegte Werke wieder zugangig gemacht. Dieses Buch vom Ewigen im Menschen ist ein unveranderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe von 1921. Der vorliegende erste Band stellt die religiosen Erneuerungen dar.
Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Lichtblau
Den kapitalismuskritischen Schriften von Max Scheler kommt ein besonderer Stellenwert zu. Scheler, der als einer der wenigen deutschen Juden zum Katholizismus konvertiert ist, hatte sich zur Zeit des Ersten Weltkrieges sowie zu Beginn der Weimarer Republik in die um 1900 zwischen Lujio Brentano, Werner Sombart, Max Weber und Ernst Troeltsch geführte Debatte über die religiösen Wurzeln des „kapitalistischen Geistes“ in einer sehr produktiven, heute weitgehend vergessenen Weise eingemischt und dabei eine höchst eigenwillige Position vertreten.
In 1964, Astrid Kirchherr and Max Scheler travelled to England to photograph The Beatles as they prepared to star in their first feature film, 'A Hard Day's Night'. A stunning collection of images, 'Yesterday' is a fascinating record of the world's first supergroup.