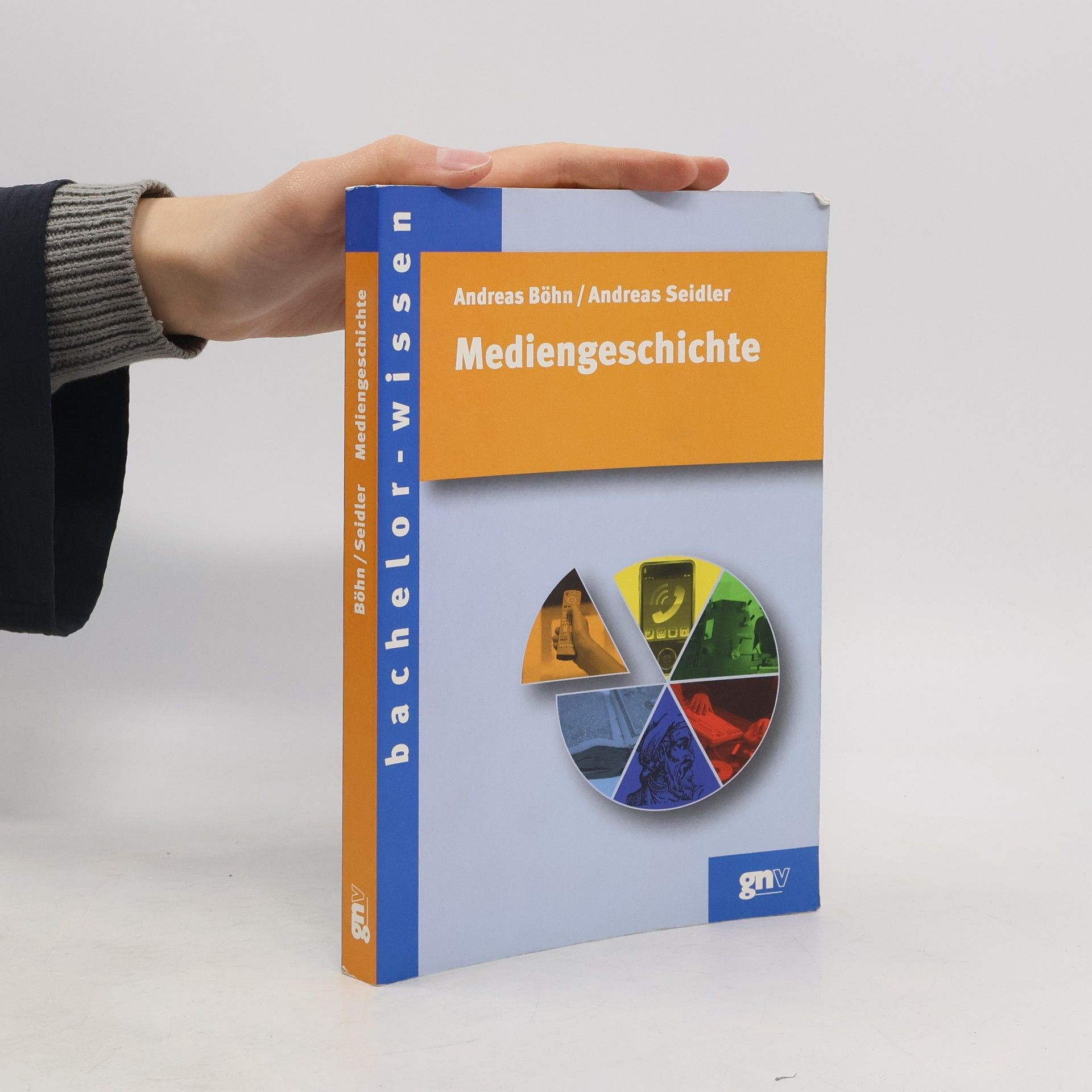Der Band bietet einen Überblick über die Geschichte der Medien von der Erfindung der Schrift bis zum Internet. Dabei wird nicht nur in anschaulicher Weise mit durchgehendem Bezug auf Beispiele historisches Grundwissen vermittelt, sondern ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, das Verständnis zu wecken für die gesellschaftlichen und mentalen Veränderungen, die die Einführung neuer Medien stets mit sich gebracht haben. So wird zunächst die begriffliche Grundausstattung geliefert, um sich das Phänomen der Medien zu erschließen. Nach einem historischen Durchlauf, der die wesentlichen Etappen der Mediengeschichte vorstellt, wird schließlich die aktuelle Medienwelt unter übergreifenden Aspekten wie dem Verhältnis von Medien und Wirklichkeit oder der Wirkung von Medien beleuchtet. Alle Kapitel werden ergänzt durch Kontrollfragen, die noch einmal auf die zentralen Zusammenhänge verweisen und das Verständnis vertiefen. Aus dem Inhalt: - Kommunikations- und Zeichentheorie - Medienbegriffe - Mündlichkeit/Schriftlichkeit - Text, Buch, Druck - Zeitung/Entstehung von Öffentlichkeit - Sprache und Bild - Photographie - Film - Radio und Fernsehen - Digitale Medien - Multimedia - Intermedialität/Selbstreflexivität - Medienwelten - Mediennutzung/Medienwirkung
Andreas Böhn Bücher
10. April 1963