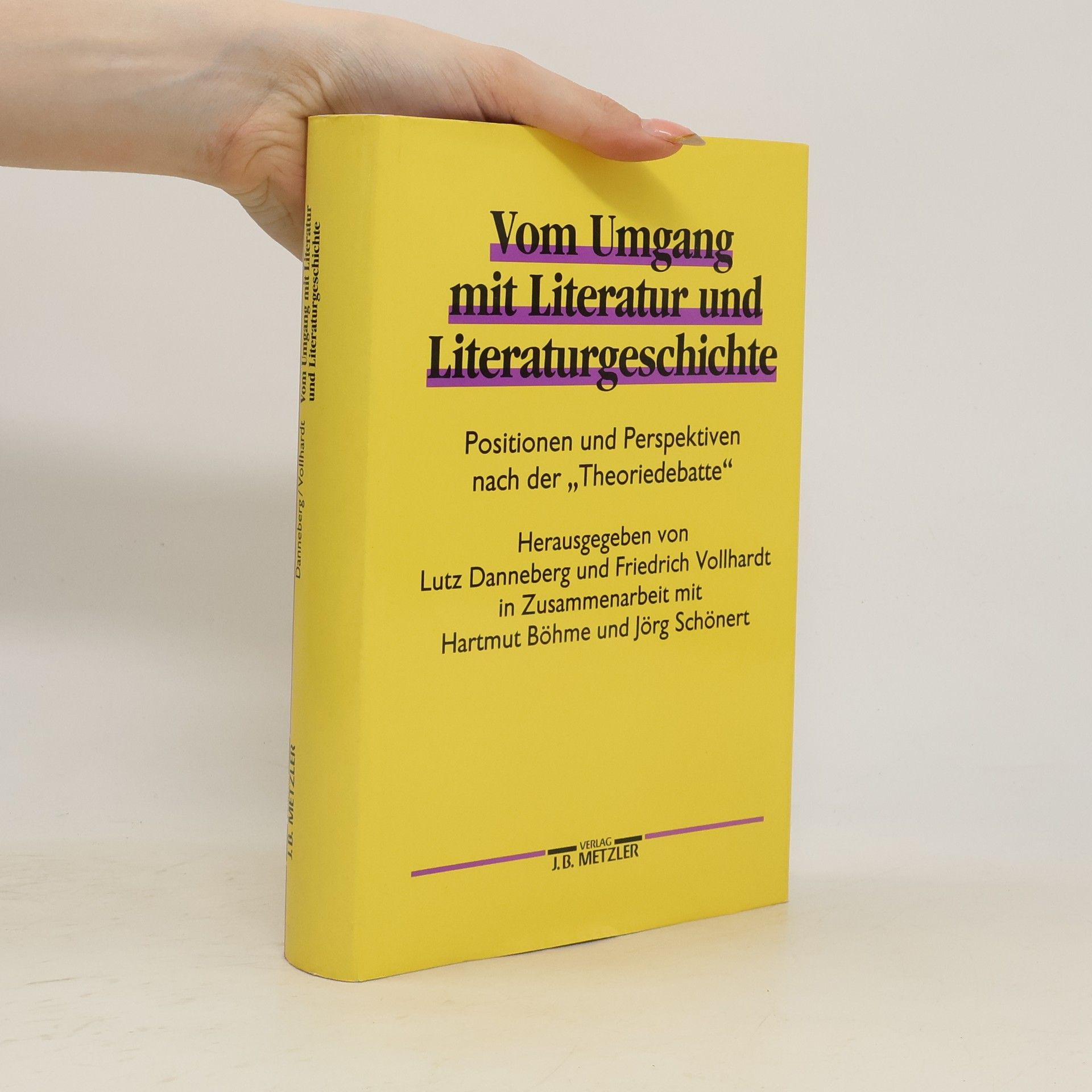August Boeckh und die philologische Methodenlehre
Methodologie und Enzyklopädie, Methode und Kunst, Hermeneutik
- 240 Seiten
- 9 Lesestunden
Die Untersuchung beleuchtet die Beiträge und das Werk von August Boeckh, einem einflussreichen deutschen Philologen und Altertumswissenschaftler. Sie analysiert seine Methodik und seine Ansichten zur griechischen und römischen Literatur sowie zur Sprachwissenschaft. Besonderes Augenmerk liegt auf Boeckhs Einfluss auf die moderne Wissenschaft und seine Rolle in der Entwicklung der Altertumsforschung. Die Arbeit bietet tiefgehende Einblicke in seine Theorien und deren Relevanz für heutige akademische Diskurse.