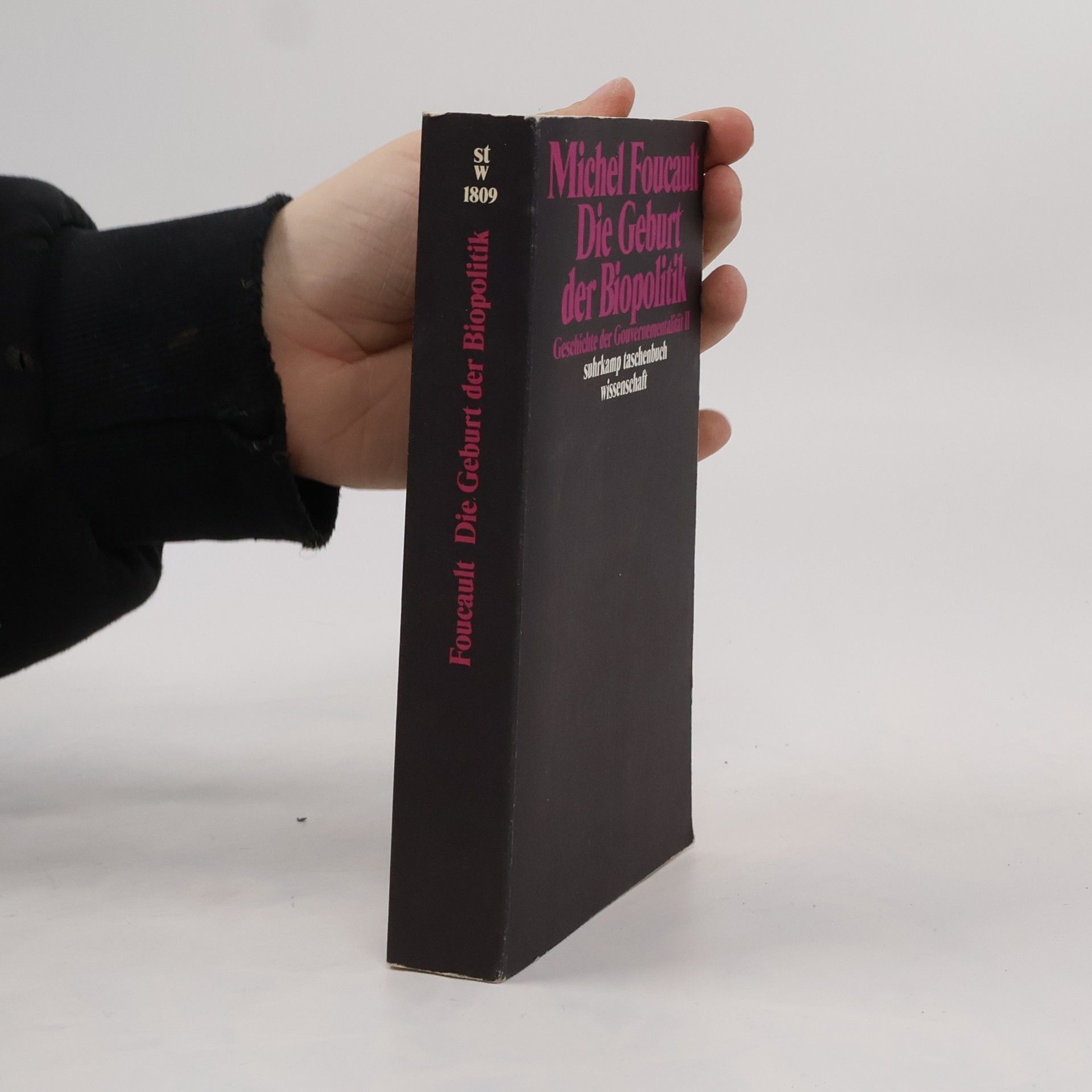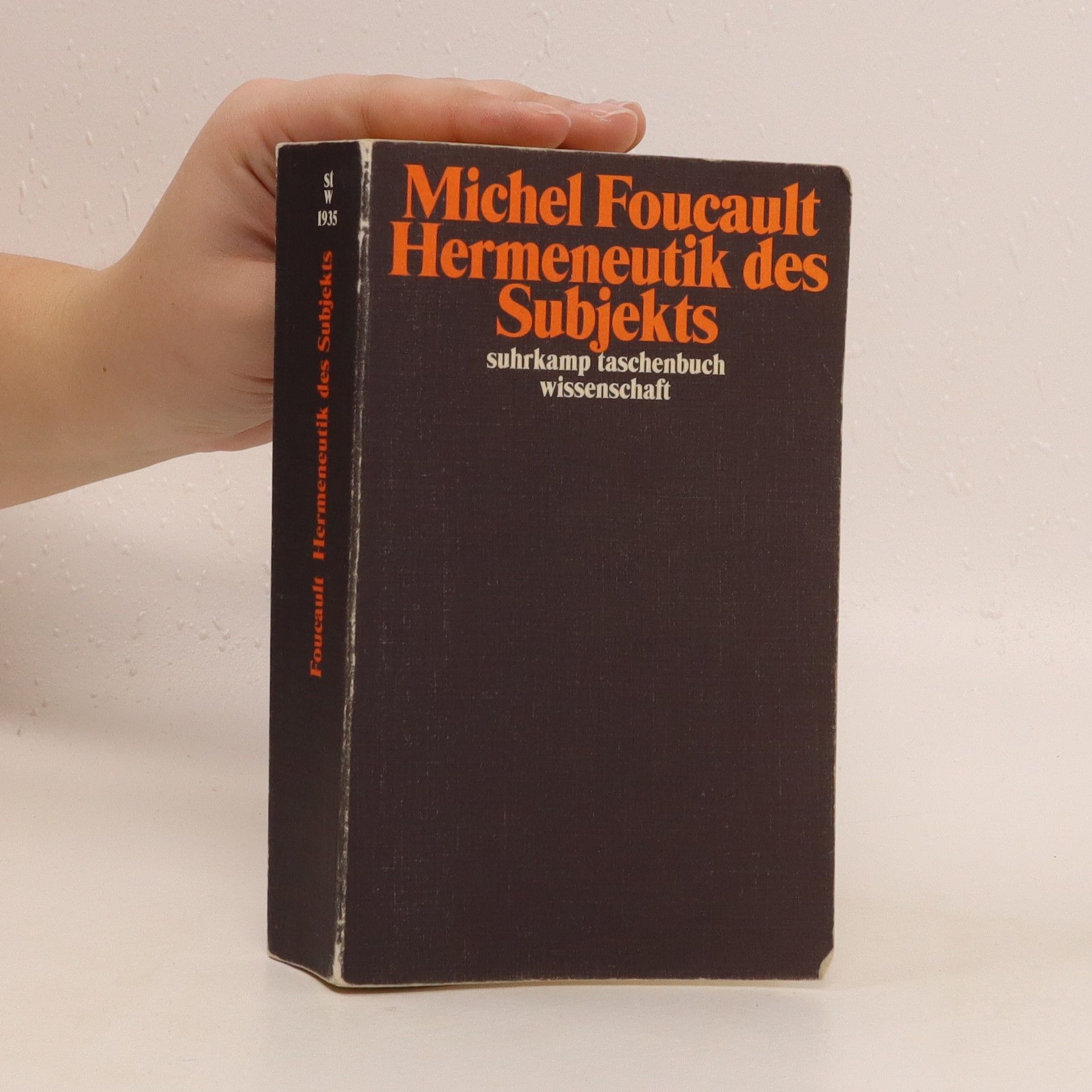Der Wille zum Wissen, die Sorge des Subjekts um sich selbst und die Selbsttechnologien erscheinen als zentrale Themen in Michel Foucaults Spätwerk. Überraschend ist jedoch die Entdeckung, dass bereits seine ersten Vorlesungen am Collège de France aus den Jahren 1970 und 1971 diese Fragen aufgreifen. Die übliche Dreiteilung seiner Werkphasen in eine frühe "Archäologie des Wissens", eine mittlere "Genealogie der Disziplinargesellschaft" und schließlich eine späte Geschichte der "Selbsttechnologien" und "Gouvernementalität" erweist sich als fragwürdig. Die Vorlesungen zeigen bereits deutliche Spuren der späteren Gedanken zu Selbsttechnologien, während auch Motive der Archäologie des Wissens und der sich entwickelnden Genealogie der Disziplinargesellschaft erkennbar sind. Foucault beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie eine Geschichte der Wahrheit oder der Diskurse über Wahrheit zu schreiben ist. Er beginnt in der griechischen Antike und verfolgt das Thema bis zu Nietzsche, einem für sein Werk wichtigen Autor. In der Frage nach der Wahrheit und ihrer Geschichte scheinen alle Motive seines Œuvres bereits Anfang der 1970er Jahre zusammenzulaufen. Ein bemerkenswertes Dokument, das nicht nur für Foucault-Kenner, sondern auch für Interessierte von Bedeutung ist.
Vorlesungen am Collège de France Reihe
Diese Reihe macht die bahnbrechenden Vorlesungen eines der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts zugänglich. Leser tauchen tief in tiefgründige Analysen gesellschaftlicher Strukturen, Macht und Wissen ein. Dies ist unerlässlich für jeden, der sich für Philosophie, Ideengeschichte und kritische Theorie interessiert. Die Vorlesungen bieten einen einzigartigen Einblick in den intellektuellen Prozess des Denkers und seinen bleibenden Einfluss auf die moderne Welt.
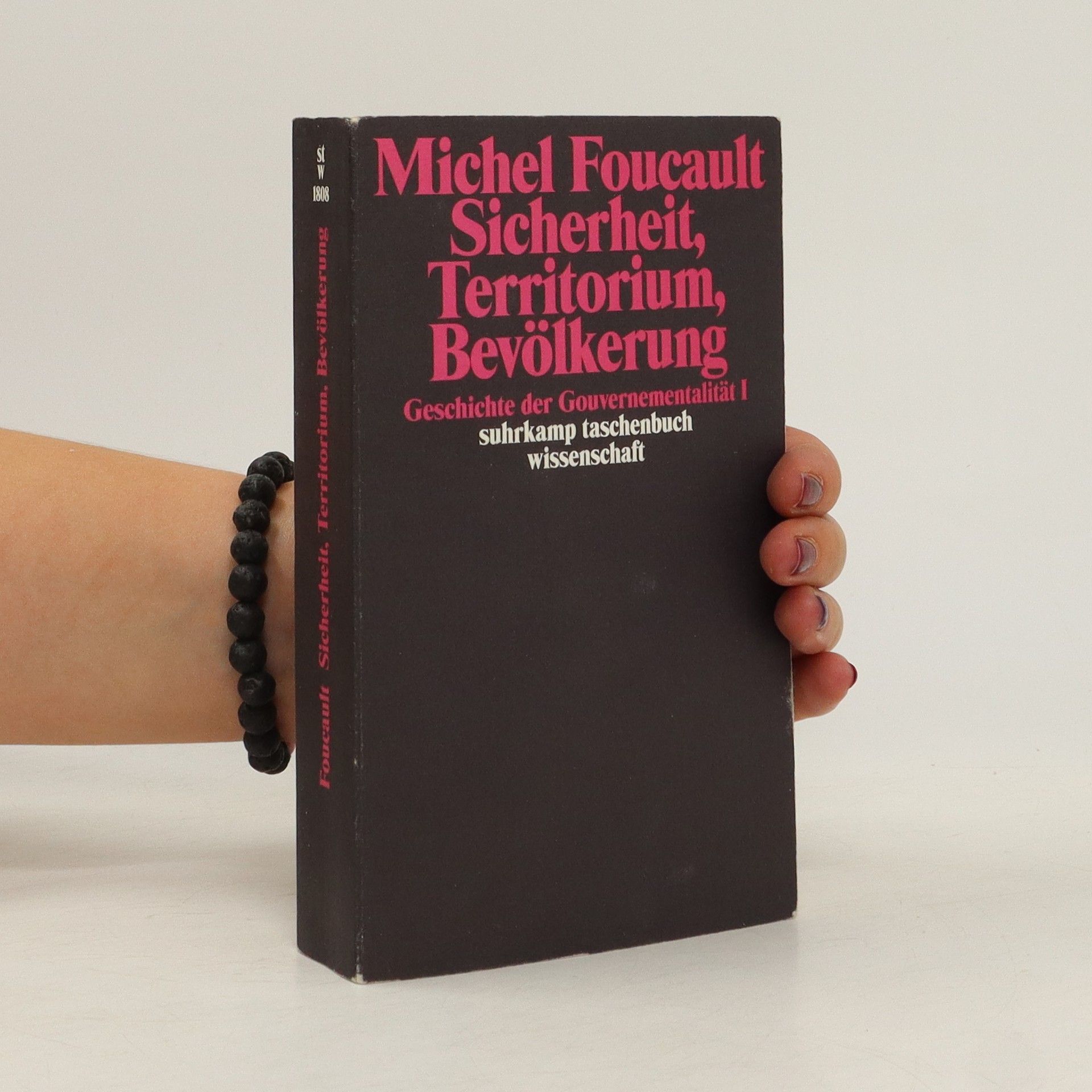
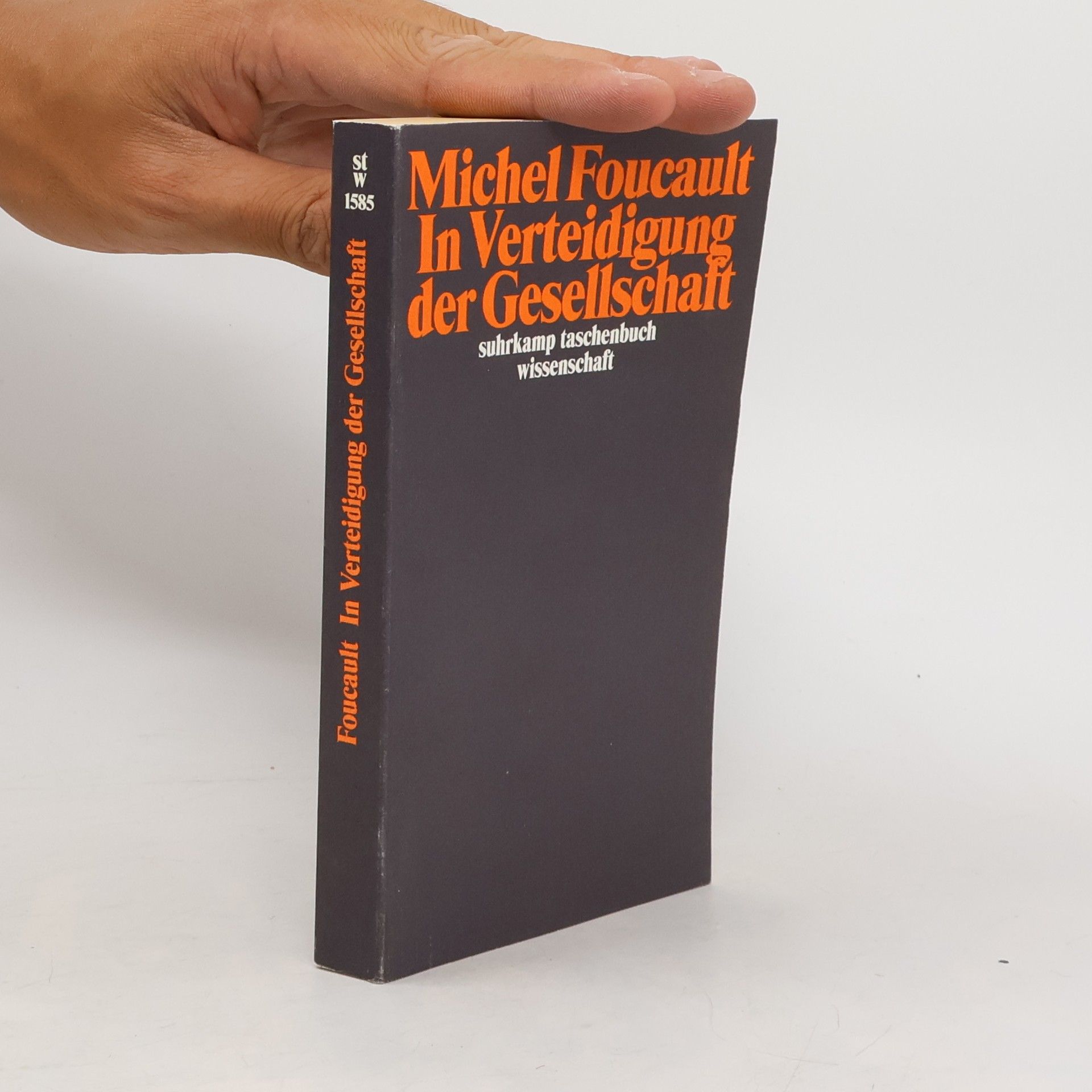
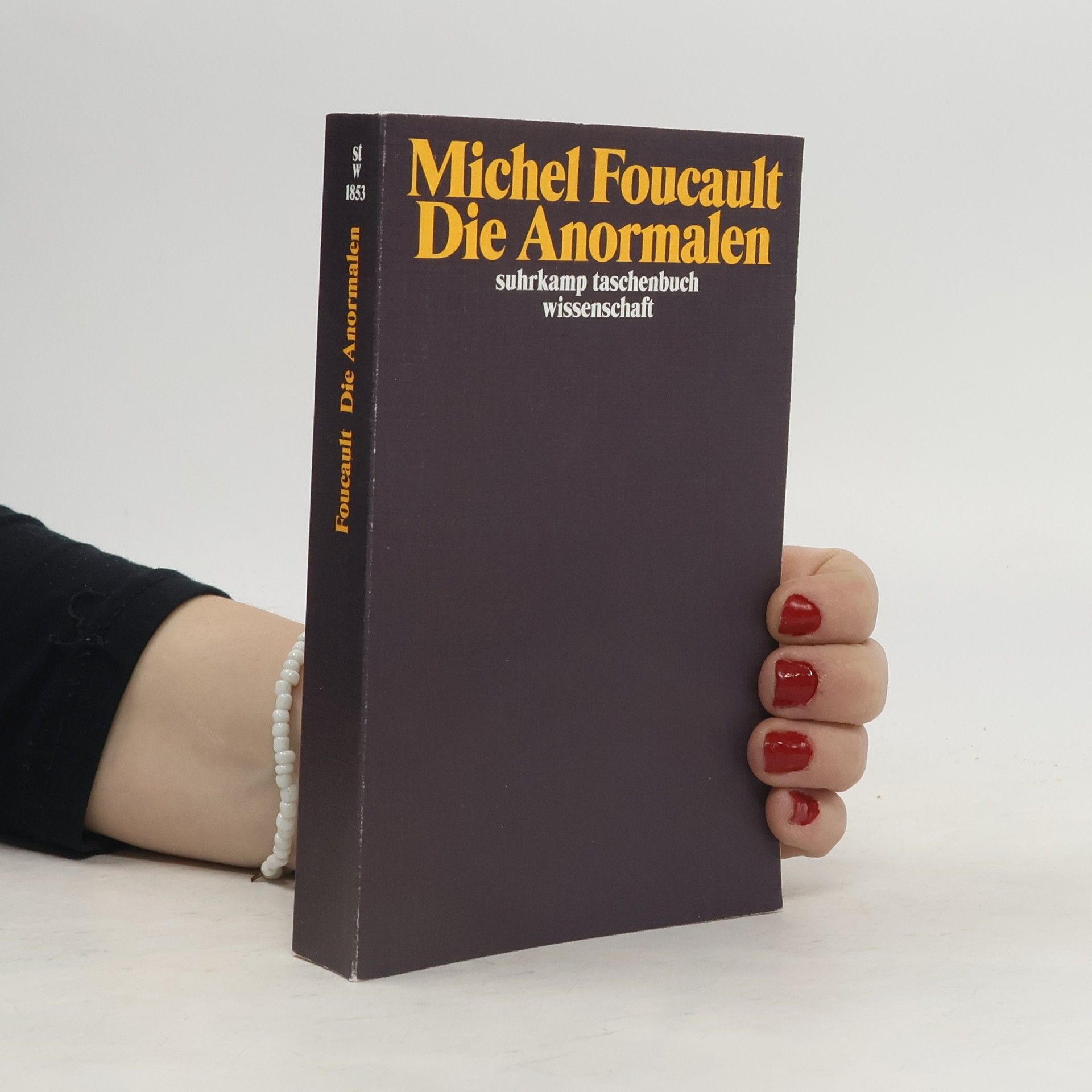
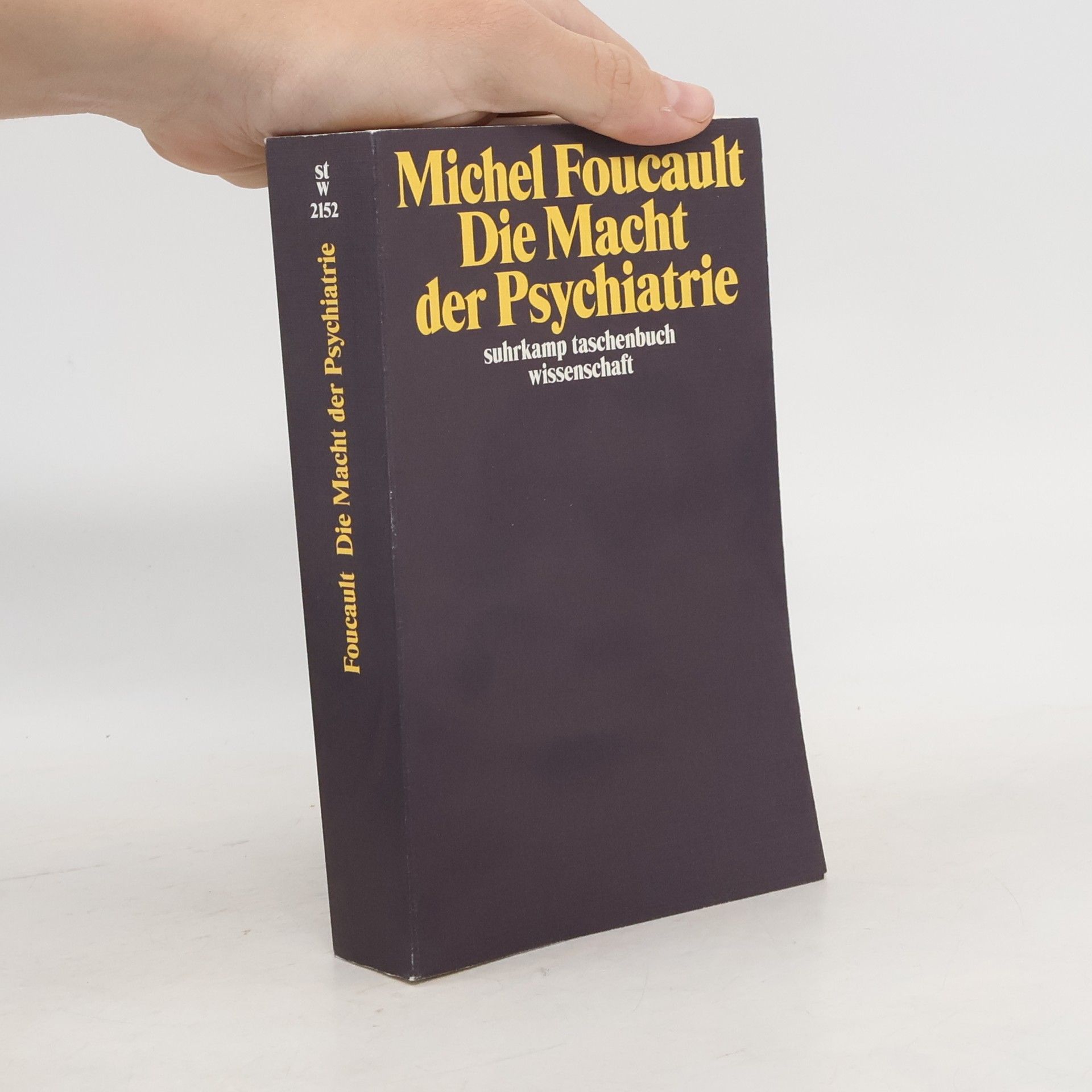


Empfohlene Lesereihenfolge
Die Strafgesellschaft
Vorlesungen am Collège de France 1972–1973
Michel Foucaults in den Jahren 1972 und 1973 gehaltene große Vorlesungen Die Strafgesellschaft untersuchen die Beziehungen zwischen Recht und Wahrheit und wie beide sich verbunden haben, um zur Entstehung eines neuen Strafregimes beizutragen, das unsere Gesellschaften bis heute bestimmt. Sie sollten der Vorbereitung von Foucaults wirkmächtigem Buch Überwachen und Strafen dienen, entfalten aber eine ganz eigene Dynamik, die über eine Genealogie des Gefängnissystems hinausgeht und die gesamte kapitalistische Gesellschaft in den Blick nimmt als eine spezifische Organisation vielfältiger Regelverstöße. Foucault arbeitet sich durch ein zuvor für die klassische politische Ökonomie unerschlossenes historisches Material: den Diskurs der englischen Quäker und Dissenter, ihre Philanthropie und ihre Moralisierung der Arbeitszeit, die den modernen Strafvollzug hervorbringen. Im Zuge einer Kritik an Hobbes liefert Foucault vor diesem Hintergrund eine Analyse des Bürgerkriegs, den er nicht als einen Krieg aller gegen alle begreift, sondern als eine allgemeine Matrix der Funktionsweise von Strategien der Strafe, deren Ziel weniger der Kriminelle als der innere Feind ist. Die Strafgesellschaft kann als bahnbrechende Analyse der Entstehung der modernen Gesellschaft zweifellos zu den großen Werken über die Geschichte des Kapitalismus gerechnet werden.
Die Macht der Psychiatrie
Vorlesungen am Collège de France 1973–1974
In Die Macht der Psychiatrie präsentiert Michel Foucault eine Genealogie der modernen Psychiatrie und der spezifischen Wissensformen, die sie hervorgebracht hat. Man kann, so seine These, den Erkenntnissen der Psychiatrie über den Wahnsinn nur dann Rechnung tragen, wenn man sie ausgehend von den Dispositiven und Wissenstechniken analysiert, die die Behandlung der Kranken bestimmen. Foucaults brillante Untersuchung konzentriert sich vor allem auf die Frühzeit der Psychiatrie von Pinel bis Charcot und schließt mit einer Betrachtung der »Depsychiatrisierung« des Wahnsinns in den Neurowissenschaften und der Psychoanalyse, die über die Bewegung der Antipsychiatrie bis in die Gegenwart wirkt.
Die Anormalen
Vorlesungen am Collège de France 1974/1975
In dieser Vorlesung am Collège de France, die thematisch in engem Zusammenhang mit Überwachen und Strafen steht, beschäftigt sich Foucault mit Personengruppen, die gesellschaftlich als anormal stigmatisiert worden sind. Dazu zählen, in der Reihenfolge ihres historischen Auftretens, die Monstren wie z. B. Hermaphroditen oder siamesische Zwillinge, die Korrektionsbedürftigen wie z. B. Straftäter und schließlich die Onanisten. An ihnen untersucht er das Auftauchen von Normalisierungstechniken zusammen mit den neu entstehenden Machtformen. Die Art und Weise, wie sie sich ausgebildet und installiert haben, ohne sich jemals auf eine einzige Institution zu stützen, und das Spiel, das sie zwischen den verschiedenen Institutionen betreiben, haben, so Foucault, unsere Gesellschaft bis heute zutiefst geprägt.
In Verteidigung der Gesellschaft
Vorlesungen am Collège de France 1975/1976
Neben der großen vierbändigen Ausgabe der Dits et Ecrits erscheint gegenwärtig eine umfangreiche Ausgabe der Vorlesungen Foucaults am Collège de France. In diesen Vorlesungen ist ein neuer Foucault zu entdecken: Neben der pointierten mündlichen Präsentation des Gegenstands, die seinen Denkweg verdeutlicht, findet sich immer das Bemühen um Aktualisierung, um eine Analyse der Gegenwart. Die Edition der Vorlesung aus dem Jahr 1975/76 In Verteidigung der Gesellschaft, mit der diese Edition begann, folgt Manuskripten und Tonbandmitschnitten. Foucault geht hier der Frage nach, inwieweit Machtverhältnisse nach dem Modell des Krieges analysiert werden können. Seine im doppelten Wortsinn polemischen Ausführungen lassen sich in der Frage zusammenfassen, ob, in Umkehrung von Clausewitz, die Politik die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln sei.
Diese Vorlesungen Michel Foucaults am Collège de France stehen am Anfang eines der wirkmächtigsten Konzepte der modernen Sozialwissenschaften und Politischen Philosophie – der »Gouvernementalität«. Foucaults zweibändige Geschichte der Gouvernementalität entwickelt diesen Begriff und seine theoretischen Implikationen anhand einer materialreichen Analyse der Genese des modernen Liberalismus und seines Schattens: der Biomacht. Während der erste Band den Akzent auf die Beziehungen zwischen der Regierungskunst, der Normalisierung und der Subjektivierung legt, konzentriert sich Die Geburt der Biopolitik auf den Neoliberalismus und die komplexen Relationen, die er mit dem Staat unterhält. Hinter allen historischen, soziologischen, politischen und ökonomischen Untersuchungen steht aber das, was für Foucault das eigentliche Interesse des Philosophen ausmacht: die »Politik der Wahrheit«.
Diese Vorlesungen Michel Foucaults am Collège de France stehen am Anfang eines der wirkmächtigsten Konzepte der modernen Sozialwissenschaften und Politischen Philosophie – der »Gouvernementalität«. Foucaults zweibändige Geschichte der Gouvernementalität entwickelt diesen Begriff und seine theoretischen Implikationen anhand einer materialreichen Analyse der Genese des modernen Liberalismus und seines Schattens: der Biomacht. Während der erste Band den Akzent auf die Beziehungen zwischen der Regierungskunst, der Normalisierung und der Subjektivierung legt, konzentriert sich Die Geburt der Biopolitik auf den Neoliberalismus und die komplexen Relationen, die er mit dem Staat unterhält. Hinter allen historischen, soziologischen, politischen und ökonomischen Untersuchungen steht aber das, was für Foucault das eigentliche Interesse des Philosophen ausmacht: die »Politik der Wahrheit«.
Die Regierung der Lebenden
Vorlesungen am Collège de France 1979-1980
Die Vorlesungen, die Michel Foucault in den Jahren 1979 und 1980 am Collège de France gehalten hat, haben in seinem Werk eine Scharnierfunktion. Nach der Untersuchung der politischen Wahrheitsregime, die im Zentrum der großen Vorlesungen zur Gouvernementalität standen, treten hier nun die ethischen Wahrheitsregime, die Selbsttechnologien, ganz in den Fokus von Foucaults Forschungen. Ein Thema, das ihn bis zu seinem Tod beschäftigt hat. Wie kommt es, so Foucaults zentrale Frage, dass in der christlich-abendländischen Kultur von den Menschen nicht mehr nur Akte des Gehorsams und der Unterwerfung, sondern auch »Akte der Wahrheit«, des Wahrsprechens über sich selbst, über ihre Fehler, Wünsche und den Zustand ihrer Seele, verlangt werden? Zur Beantwortung dieser Frage unterzieht Foucault zunächst Sophokles' König Ödipus einer neuen Lektüre, wendet sich aber dann dem Urchristentum und dessen Praktiken der Taufe, Gewissensprüfung und Buße zu. In diesen Ritualen wird eine pastorale Ökonomie sichtbar, die um das öffentliche Geständnis kreist. Im Gegensatz zu dieser Ethik der Reinigung war die antike, heidnische Moral noch durch eine »Kunst der Existenz« bestimmt, wie sich in einem abschließenden Vergleich zeigt. Mit Die Regierung der Lebenden liegen nun Foucaults erste Untersuchungen zu diesen Fragen der Ethik und Ästhetik der Existenz vor, die den fulminanten Auftakt zu seinem Spätwerk bilden.
Michel Foucaults Vorlesungen am Collège de France aus den Jahren 1980 und 1981 markieren einen Wendepunkt in seinem Werk und leiten über zu seinen beiden letzten großen Werken Der Gebrauch der Lüste und Die Sorge um sich. Die antike Lebenskunst und Ethik tritt nun ganz in den Fokus der Analyse, mit dem Ziel einer Genealogie der Sexualmoral der Gegenwart. »Was geschah während des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung am Übergang von einer paganen zu einer christlichen Moral?«, so Foucaults Ausgangsfrage. Durch eine minutiöse Untersuchung antiker medizinischer Schriften und Abhandlungen über die Ehe, die Liebe sowie die Deutung erotischer Träume legt er ein Verhältnis des Selbst zu seinen Lüsten frei, das der christlichen Angst vor der Fleischeslust und der Konstruktion einer modernen Sexualwissenschaft vorausging. Schon im griechischen Denken beginnt sich eine Einteilung der Geschlechter nach Aktivität und Passivität zu etablieren, und bereits im Stoizismus des römischen Kaiserreichs entwickelt sich ein Modell der Ehe, das auf lebenslanger Treue basiert, sowie eine Disqualifikation der Homosexualität, jedoch integriert in eine umfassende Lebenskunst. Erst das Christentum transformiert diese Formen der Subjektivität und Sexualität zu Objekten des Wissens und einer Moral, die uns bis heute prägt. Ein bahnbrechendes Werk über die Quellen unseres modernen Selbst.
Hermeneutik des Subjekts
Vorlesungen am Collège de France 1981/82
Michel Foucaults Vorlesung »Hermeneutik des Subjekts«, die er 1981/82 am Collège de France hielt, war ein so umstrittenes wie einflußreiches Ereignis. Foucault bestimmte hier die historischen wie theoretischen Voraussetzungen eines seiner wirkmächtigsten Konzepte: der Sorge um sich. Der Entwurf einer Ästhetik der Existenz gewinnt in Foucaults subtiler Interpretation klassischer antiker Texte seine Konturen. Seine Lektüre kanonischer Texte von Platon, Mark Aurel, Epikur und Seneca zielt dabei auf eine neue Theorie des Subjekts, die sich nicht auf eine historische Rekonstruktion beschränkt, sondern versucht, eine andere – historische – Perspektive auf die Konstitution des modernen Subjekts zu gewinnen: auf die Art und Weise, wie wir uns als Subjekte zu uns selbst verhalten. Dadurch eröffnet sich zugleich eine neue Sicht auf die politischen Kämpfe der Gegenwart, die sich nun als ein Aufbegehren gegen das Verschwinden der Identität begreifen lassen.