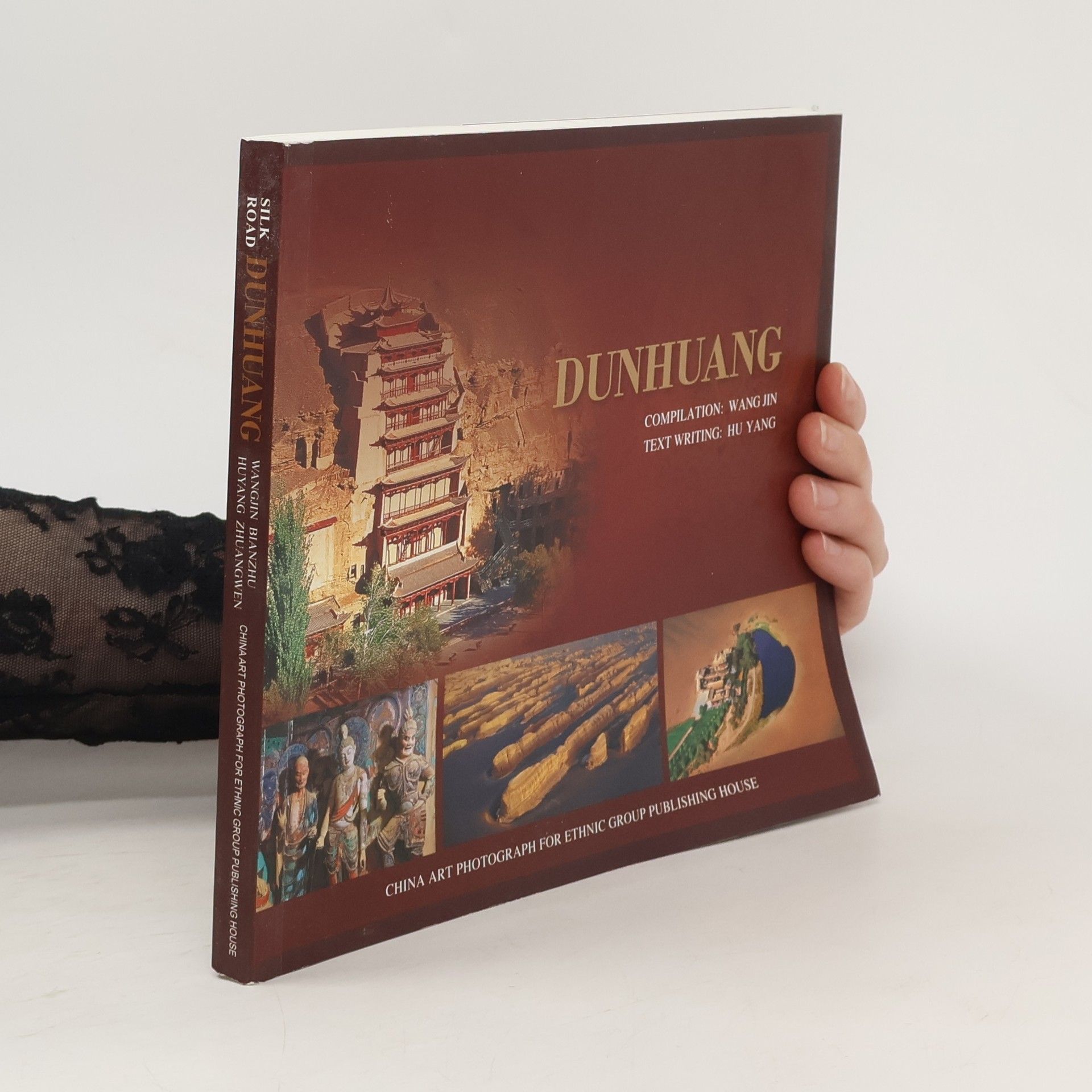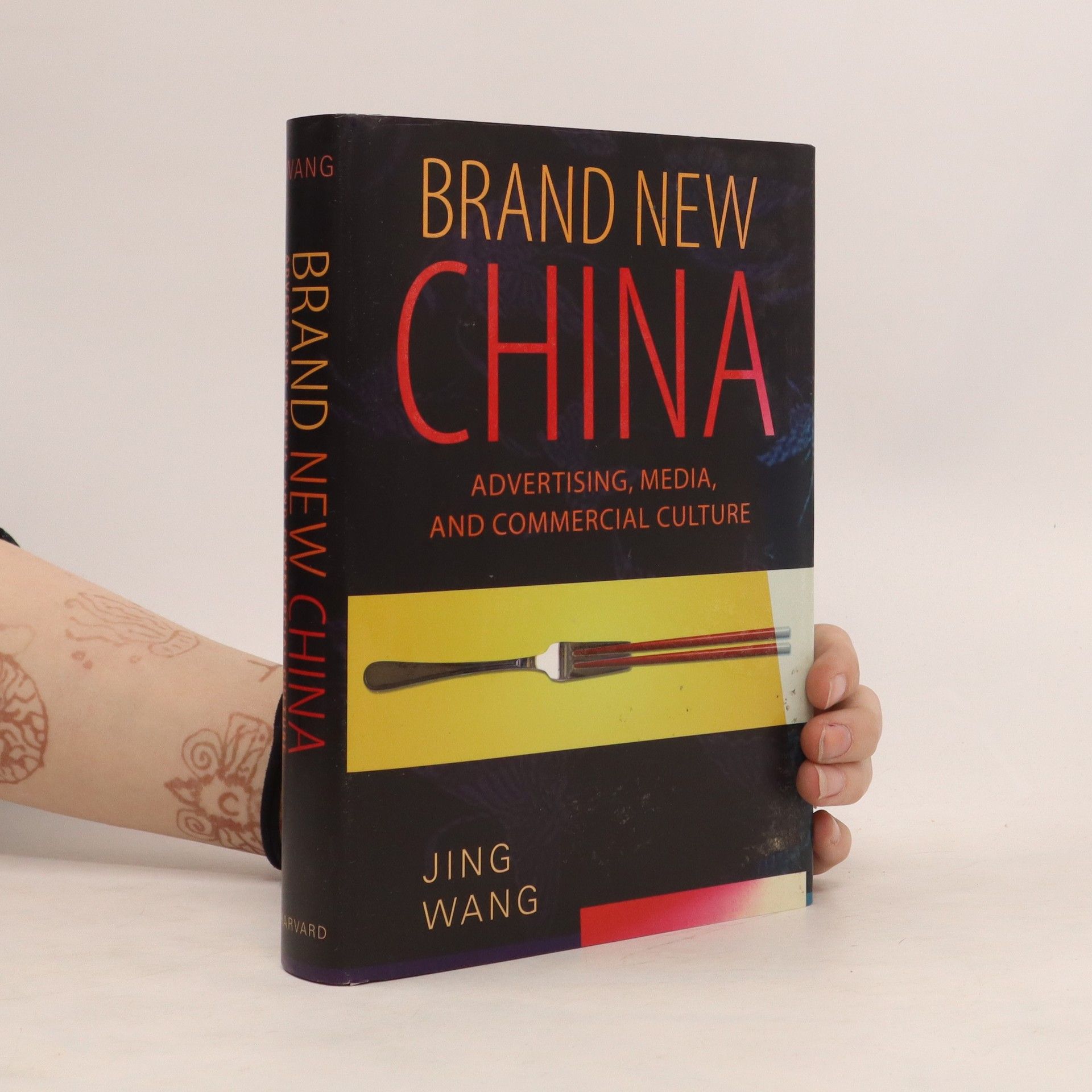Das vorliegende Buch ist eine Sammlung von zwölf Kurzgeschichten, geschrieben von Autorinnen und Autoren mit chinesischen Wurzeln aus Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweden, Ungarn und der Schweiz. Die Themen sind vielfältig und reichen von kulturellen Konflikten, Flüchtlingen und deren Integration, Coronavirus-Pandemie und dem Trauma der Nachkriegszeit bis hin zu Blicken in das ferne und geheimnisvolle China.
Jing Wang Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
Jing Wang spezialisiert sich auf chinesische Medien und Kulturwissenschaften und untersucht, wie digitale Technologien und neue Medienplattformen mit kulturellen und sozialen Transformationen interagieren. Ihre Arbeit hebt das Zusammenspiel zwischen globalen Technologien und lokalen kulturellen Kontexten hervor, insbesondere in China. Wang ist auch Gründerin und treibende Kraft hinter Initiativen, die Medienkompetenz und digitalen Aktivismus in Entwicklungsregionen fördern. Ihr Ansatz verbindet akademische Forschung mit praktischen Projekten für soziale Wirkung und zeigt ihre Vision für eine kritische Auseinandersetzung mit Medienkultur.



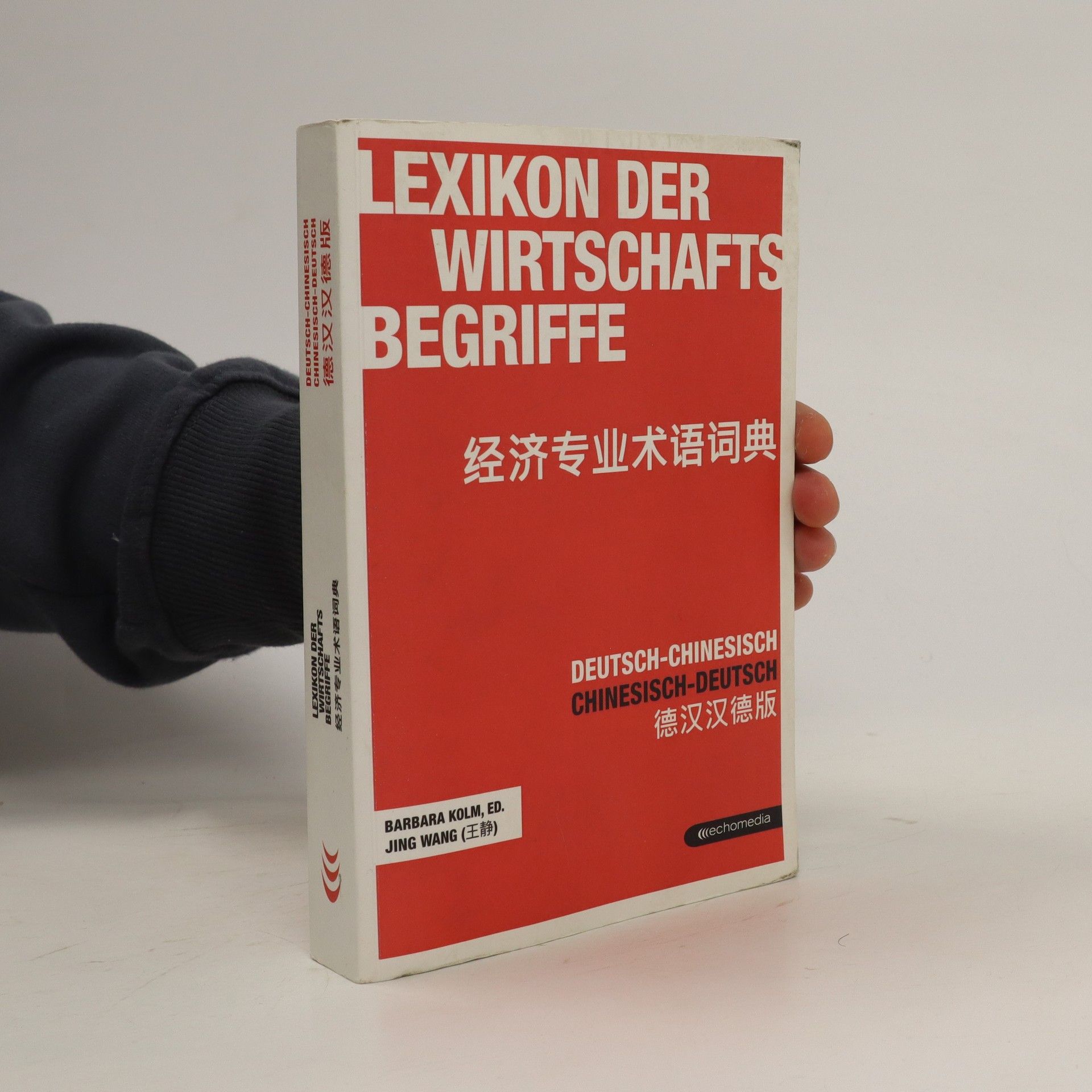

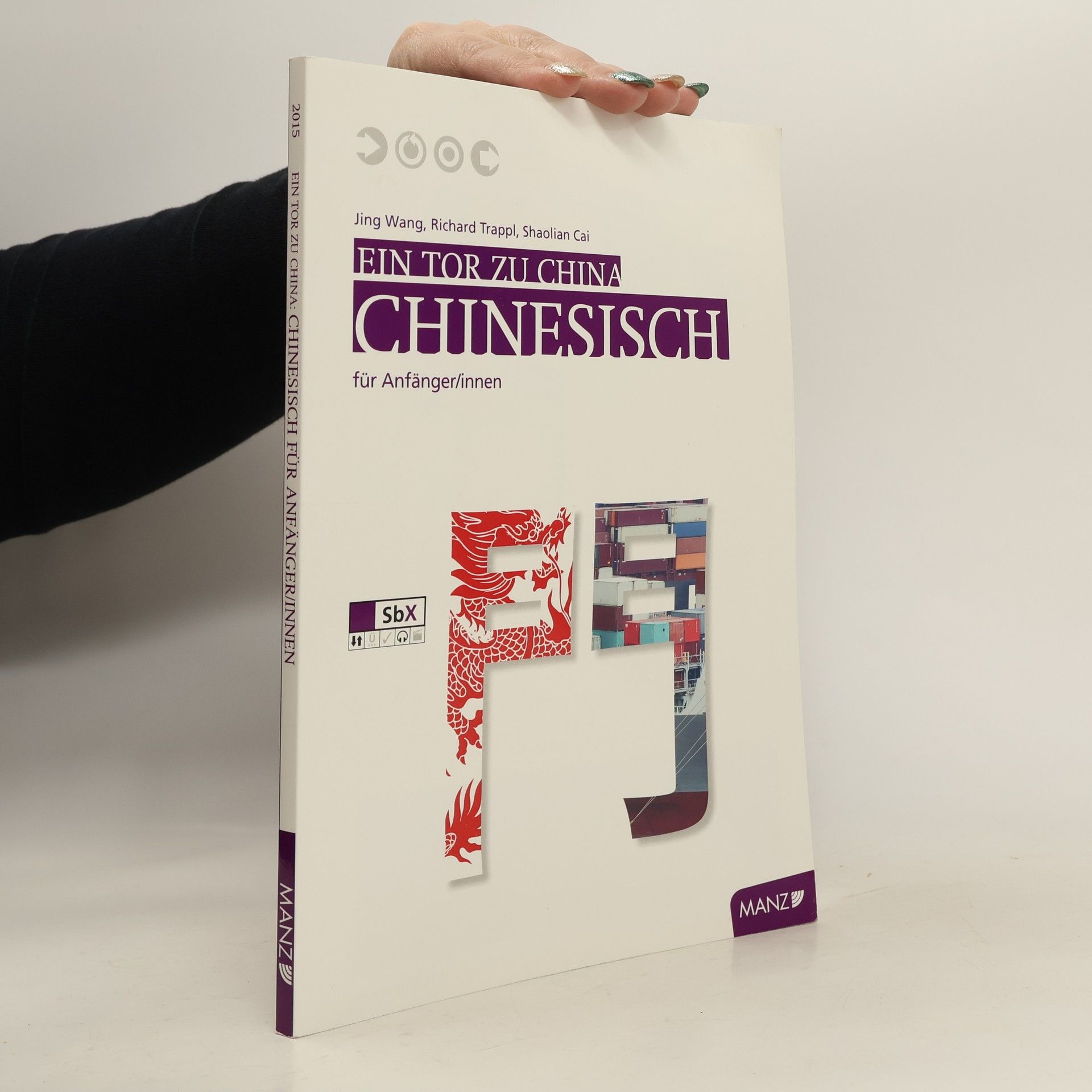
Zhan Dui. Geschmolzenes Eisen.
Die Legende von Khampa
Das Mädchen aus dem Lampendocht
und andere Märchen aus China
This is the English translation of the Chinese picture album of the same name. It is an illustrated report photography album themed with the silk road, revealing various historical and cultural remains and relics on the silk road as well as the natural sceneries and human landscapes of Western China. All the pictures are shot well and the writings and pictures are arranged reasonably. The whole book is divided into six chapters, Shaanxi, Gansu, Dunhuang, Mogao Caves, Qinghai and Sinkiang, as well as 83 independent units.
Brand New China
- 432 Seiten
- 16 Lesestunden
One part riveting account of fieldwork and one part rigorous academic study, Brand New China offers a unique perspective on the advertising and marketing culture of China. Wang's experiences in the disparate worlds of Beijing advertising agencies and the U.S. academy allow her to share a unique perspective on China during its accelerated reintegration into the global market system.