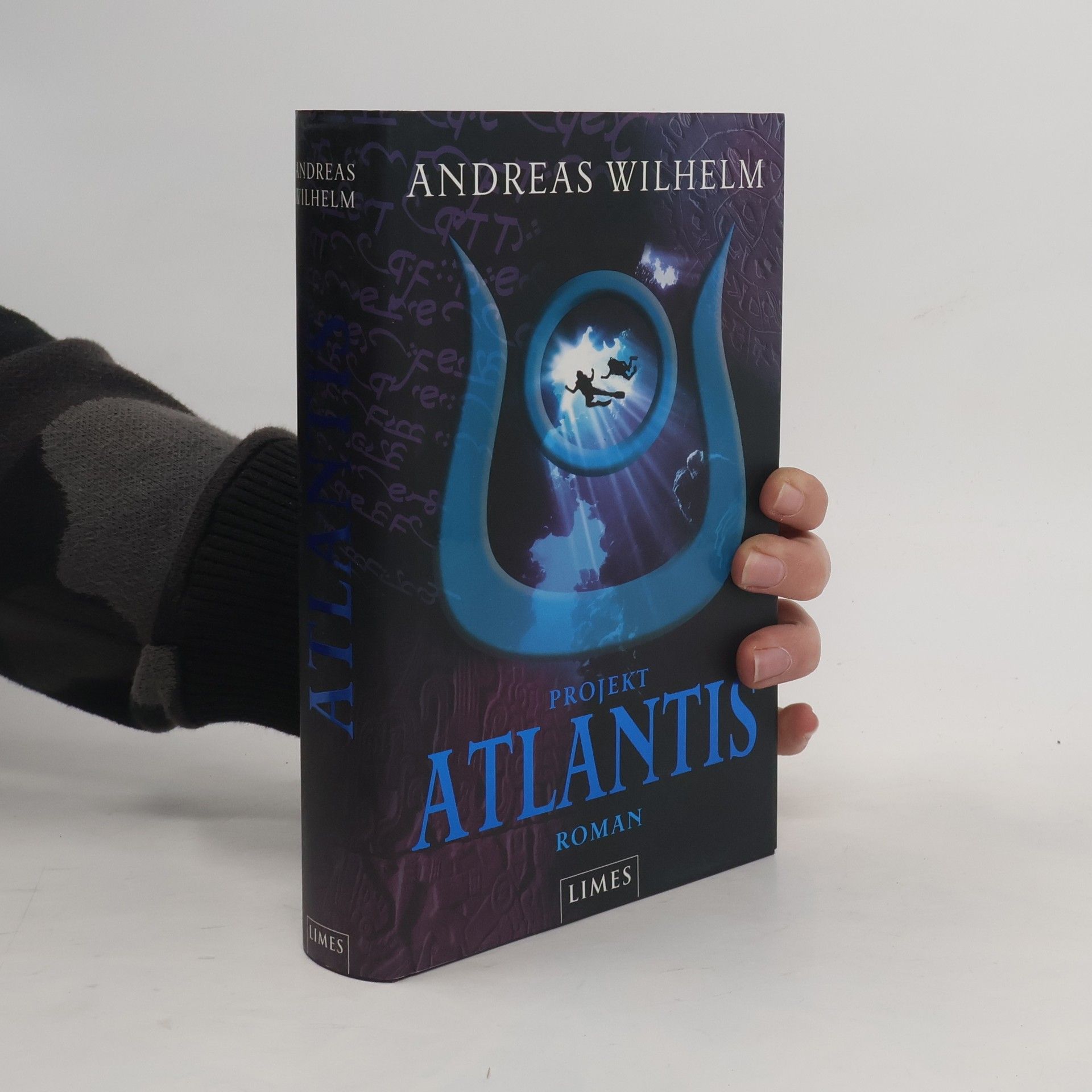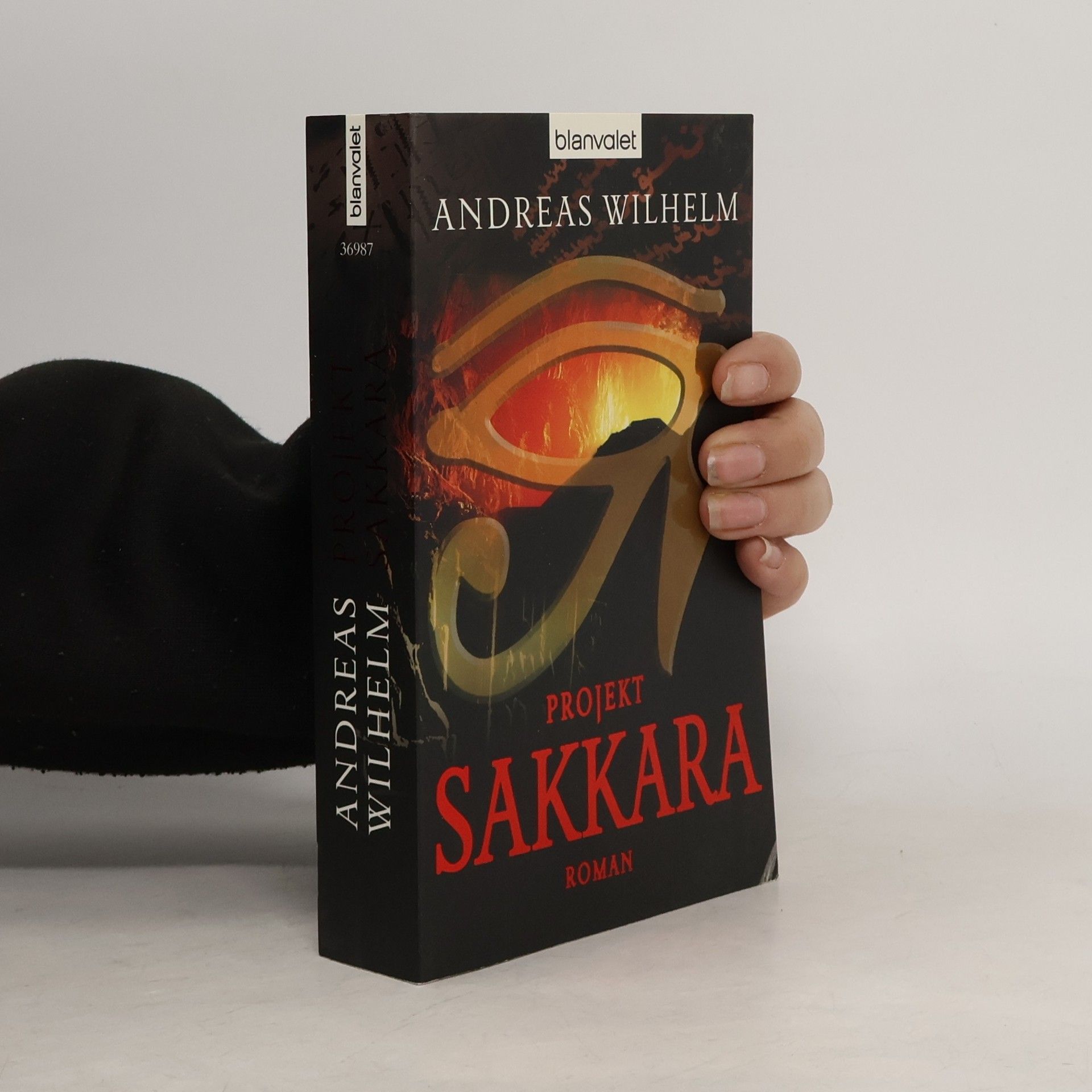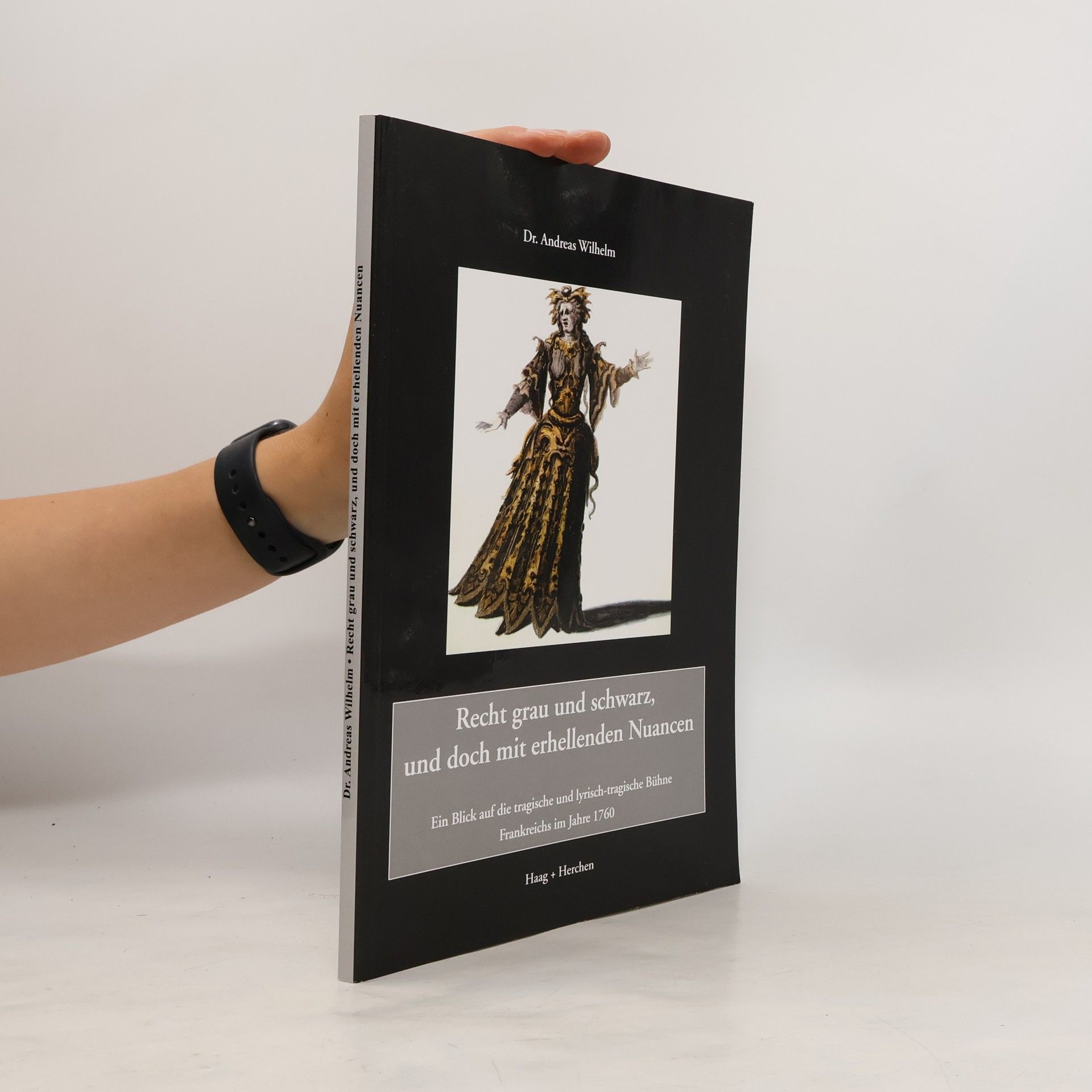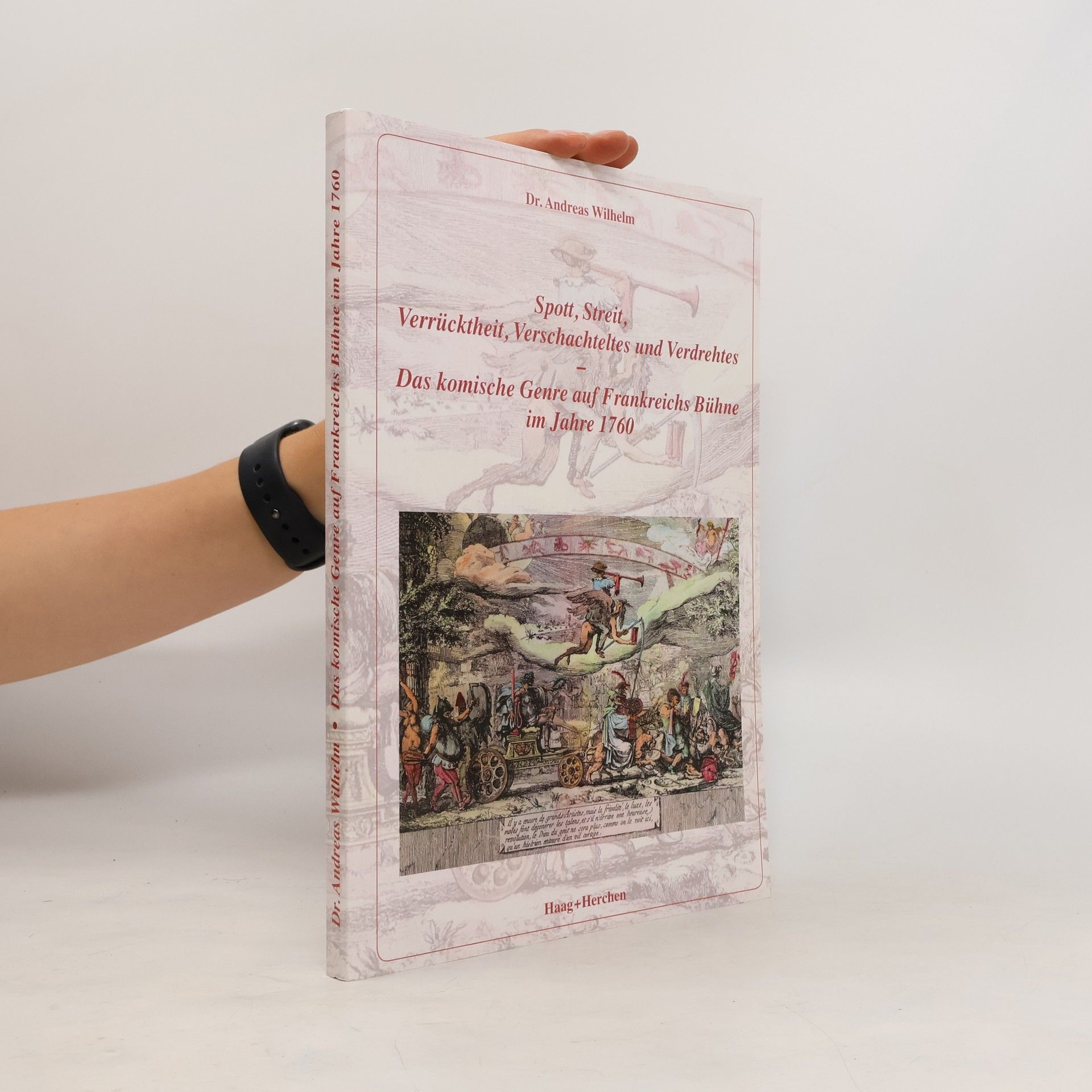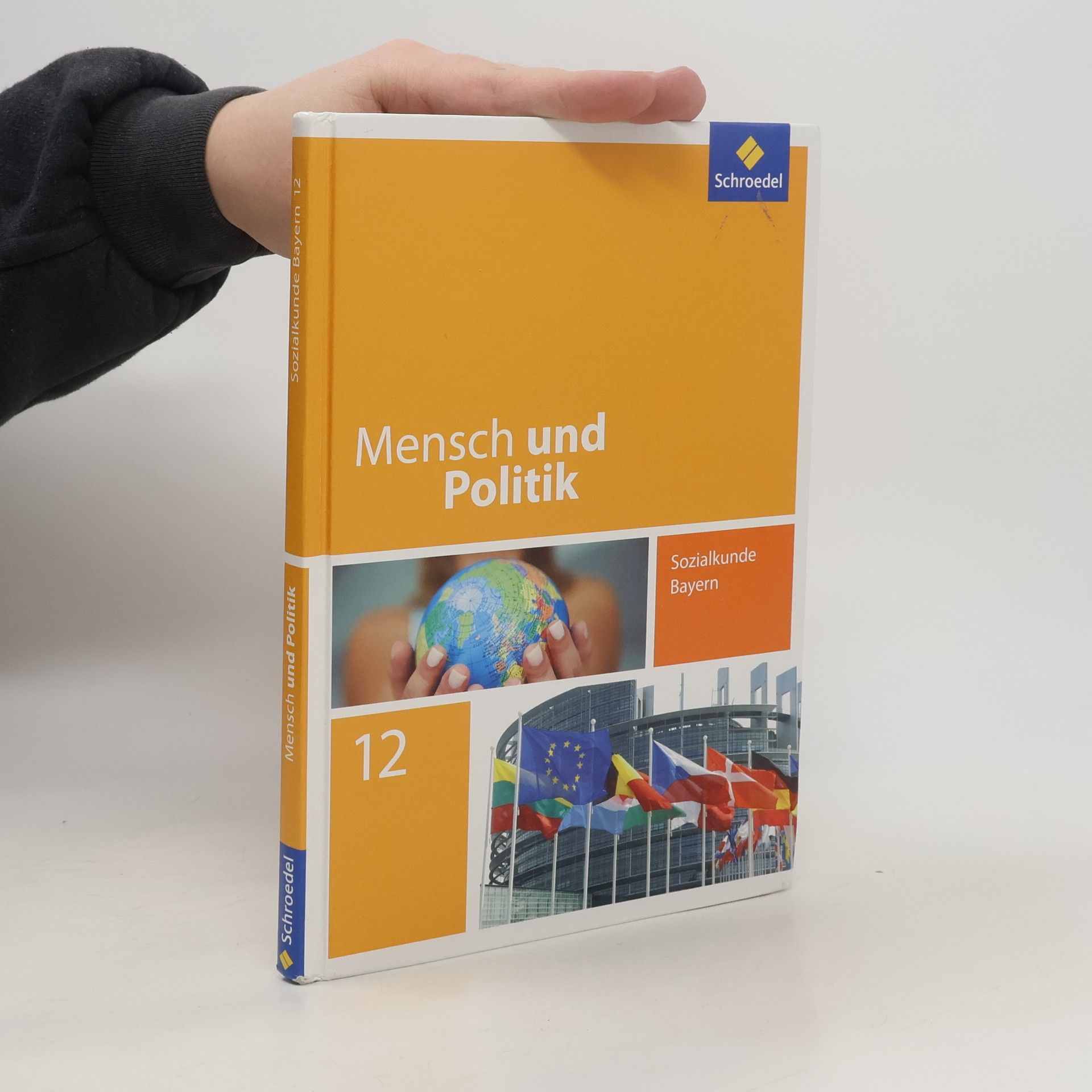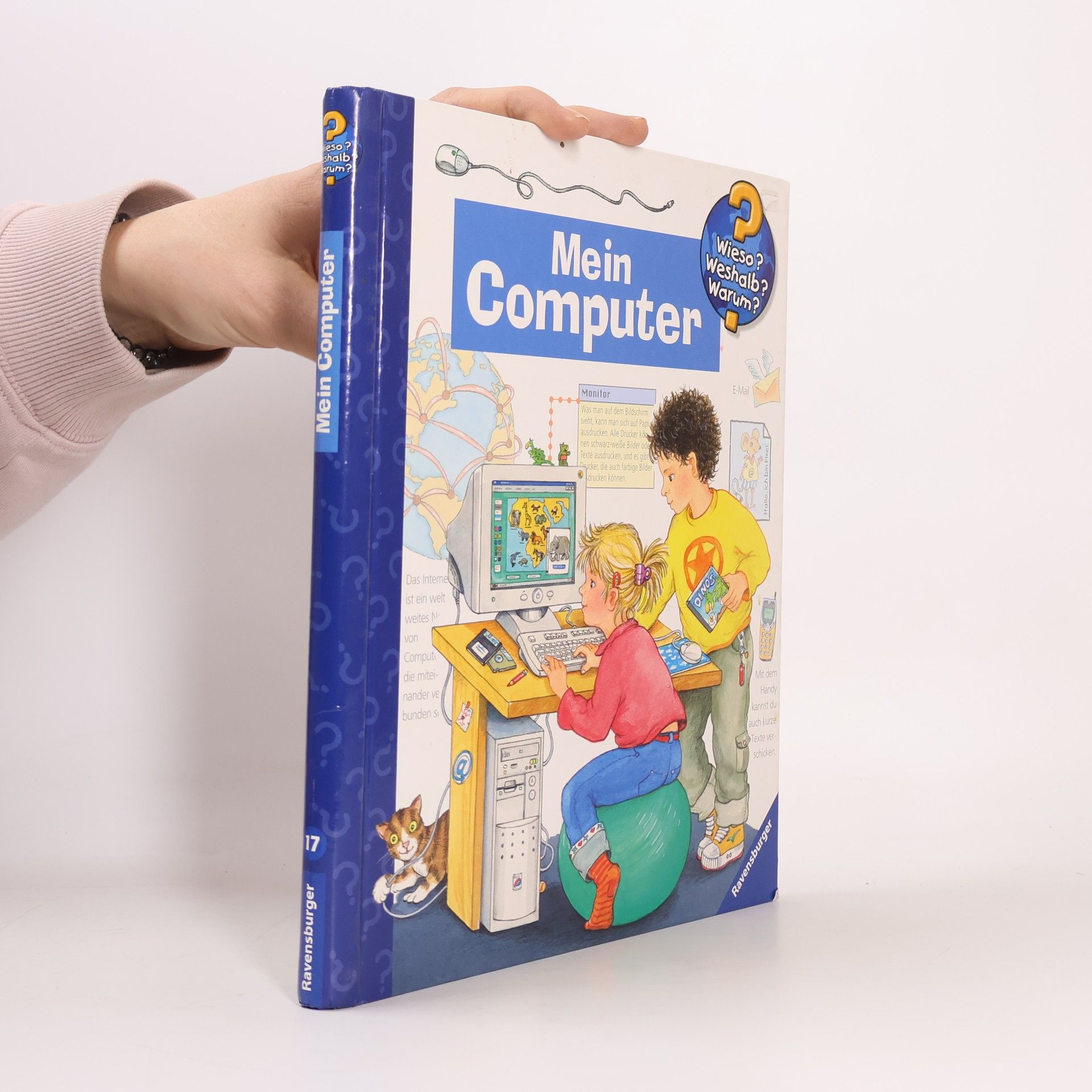Die französische Opéra-comique des 18. Jahrhunderts
Eine Synopse - Erster Teil
- 392 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Opéra-Comique, die im 18. Jahrhundert entstand, entwickelte sich aus derben Stücken der Pariser Jahrmärkte, den Foires Saint-Germain und Saint-Laurent. Selbst der Sonnenkönig besuchte 1679 eines dieser frühen Werke, was zur Vergabe eines Privilegs an die Truppe führte. Obwohl die Akrobatik in den ersten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts verschwand, war die wahre Opéra-comique noch nicht geboren. Diese Untersuchung konzentriert sich auf das gereifte Genre, das sich durch autorisierte, datierte und publizierte Stücke auszeichnet, die ausdrücklich als Opéra-comique bezeichnet werden. Autoren wie Favart, Vadé und Sedaine stehen im Vordergrund und präsentieren Werke höherer Qualität, die als Opéra-comique der zweiten Generation gelten. Diese Analyse reicht bis 1762, als die Opéra-Comique mit der Comédie-Italienne fusionierte, während das Genre weiterhin lebendig blieb. Der erste Band untersucht die Opéra-comique bis 1759 und bietet eine Synopse von 65 Stücken, die Inhalte, Mechanismen, Didaskalien und Sprache analysiert. Diese detaillierte, textimmanente Betrachtung stellt eine Neuheit in der Forschung dar. Die Rezensionen decken einen Zeitraum vom 18. Jahrhundert bis 2022 ab, zeigen jedoch, dass die moderne Rezeption oft fragmentarisch und musikalisch orientiert ist. Eine systematische Betrachtung der Librettos neueren Stils könnte einen wertvollen Beitrag zur aktuellen Forschung leisten. Der Autor ist Studienrat im Hochsc