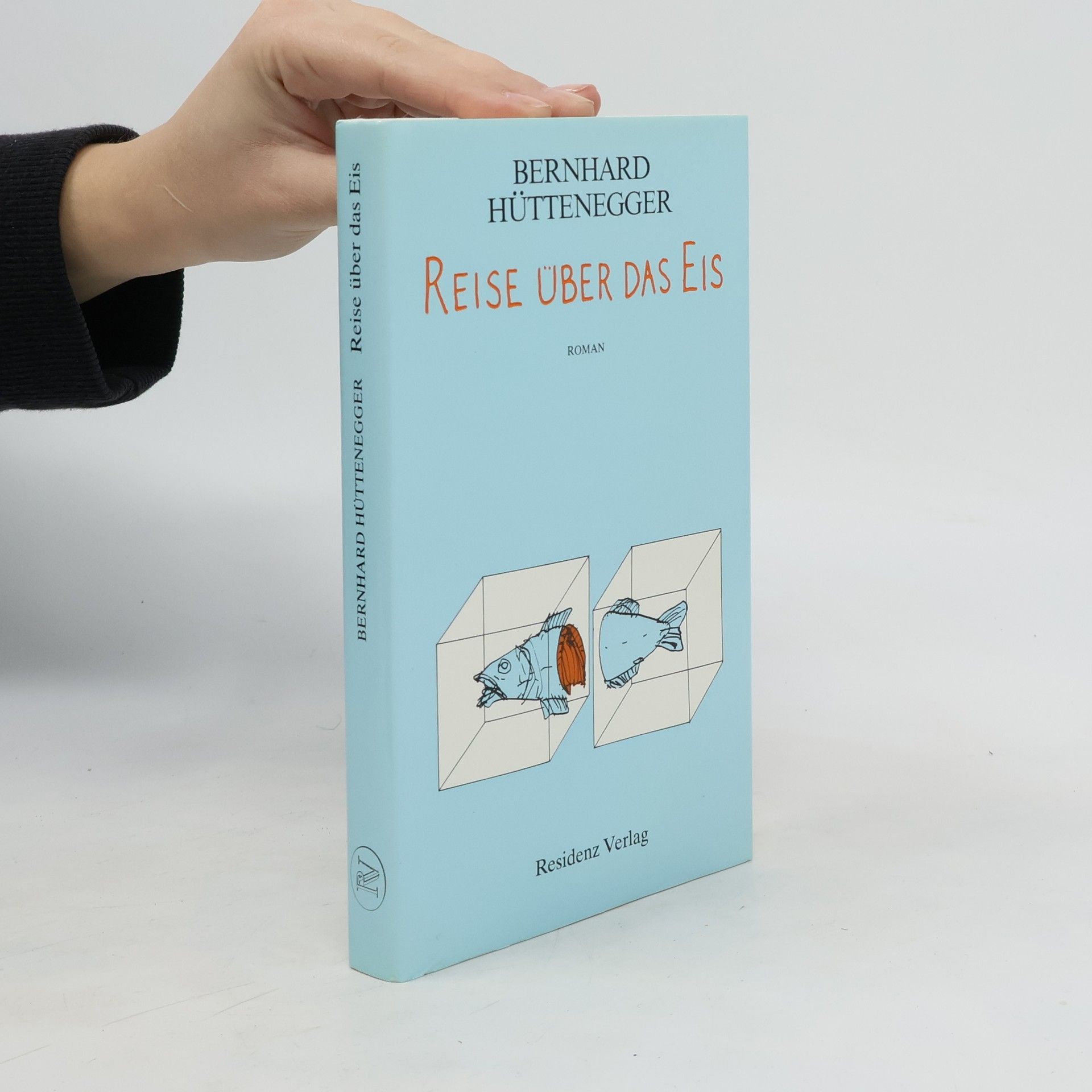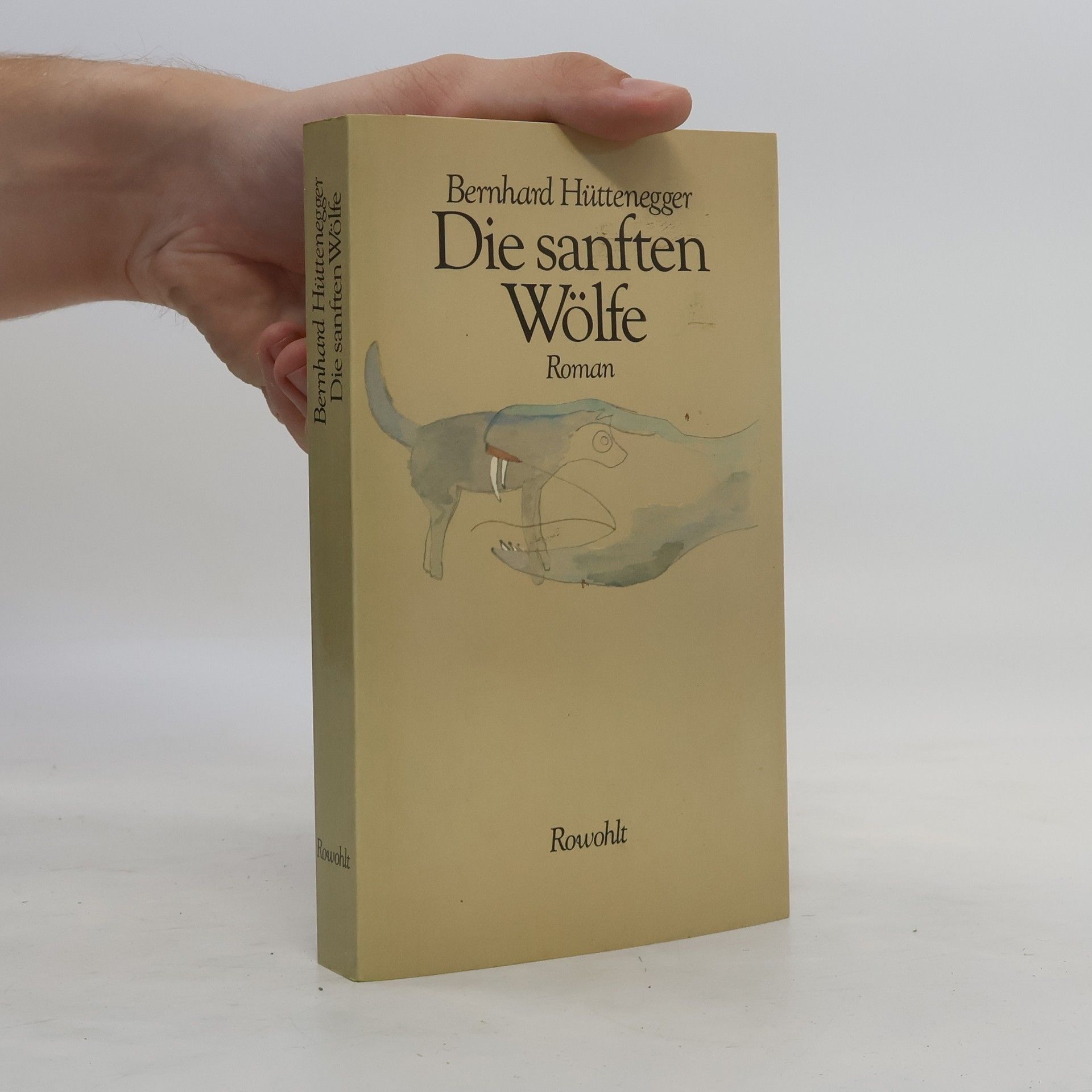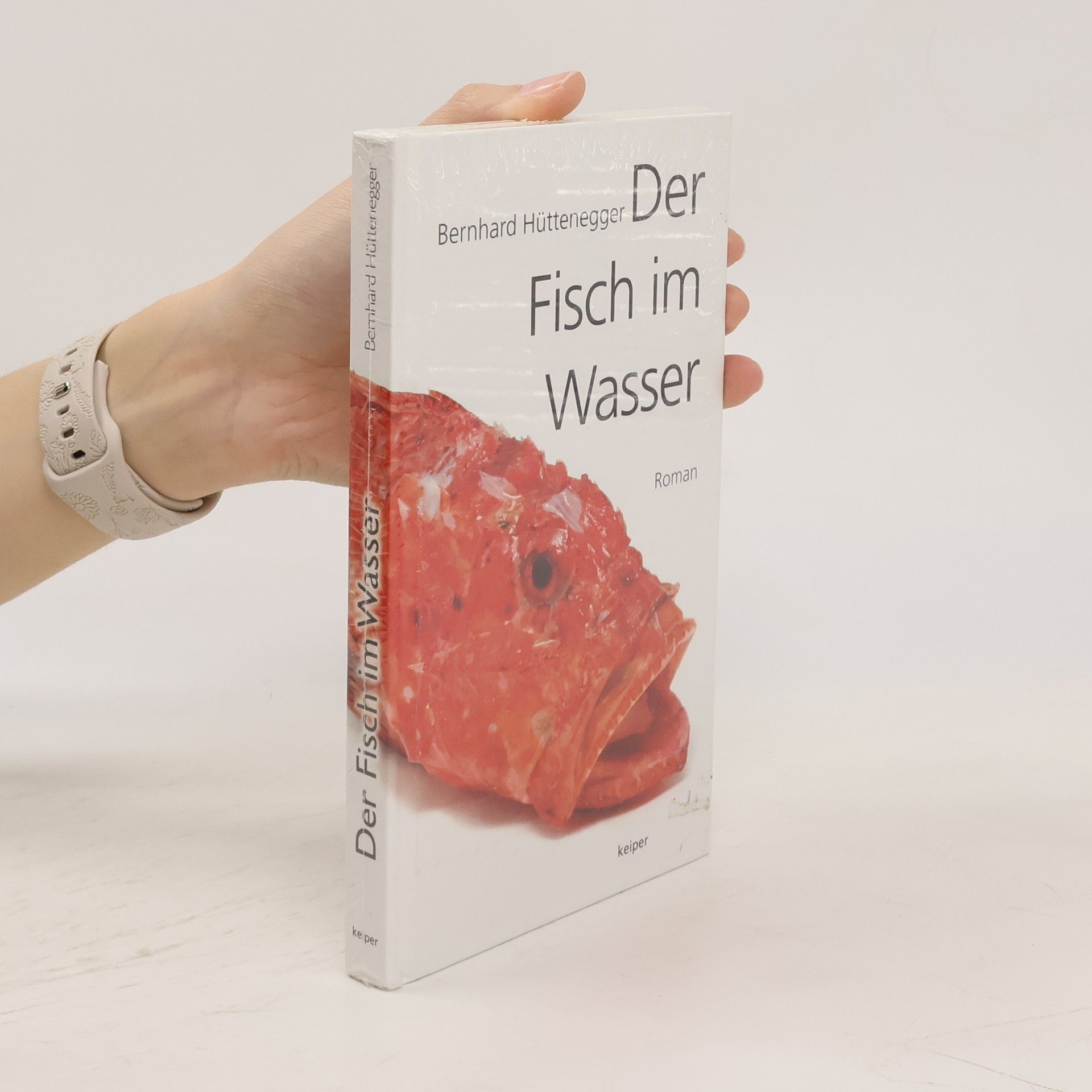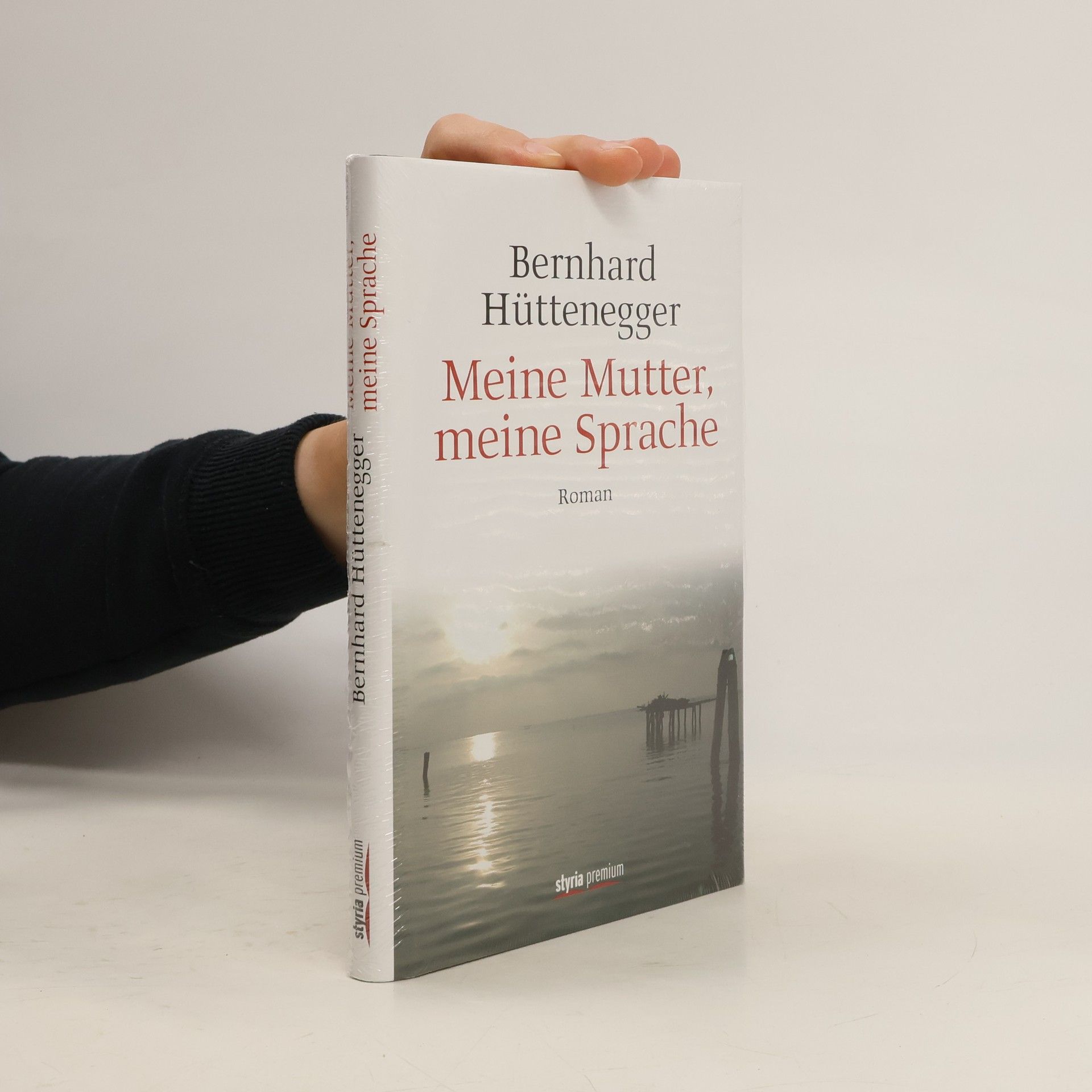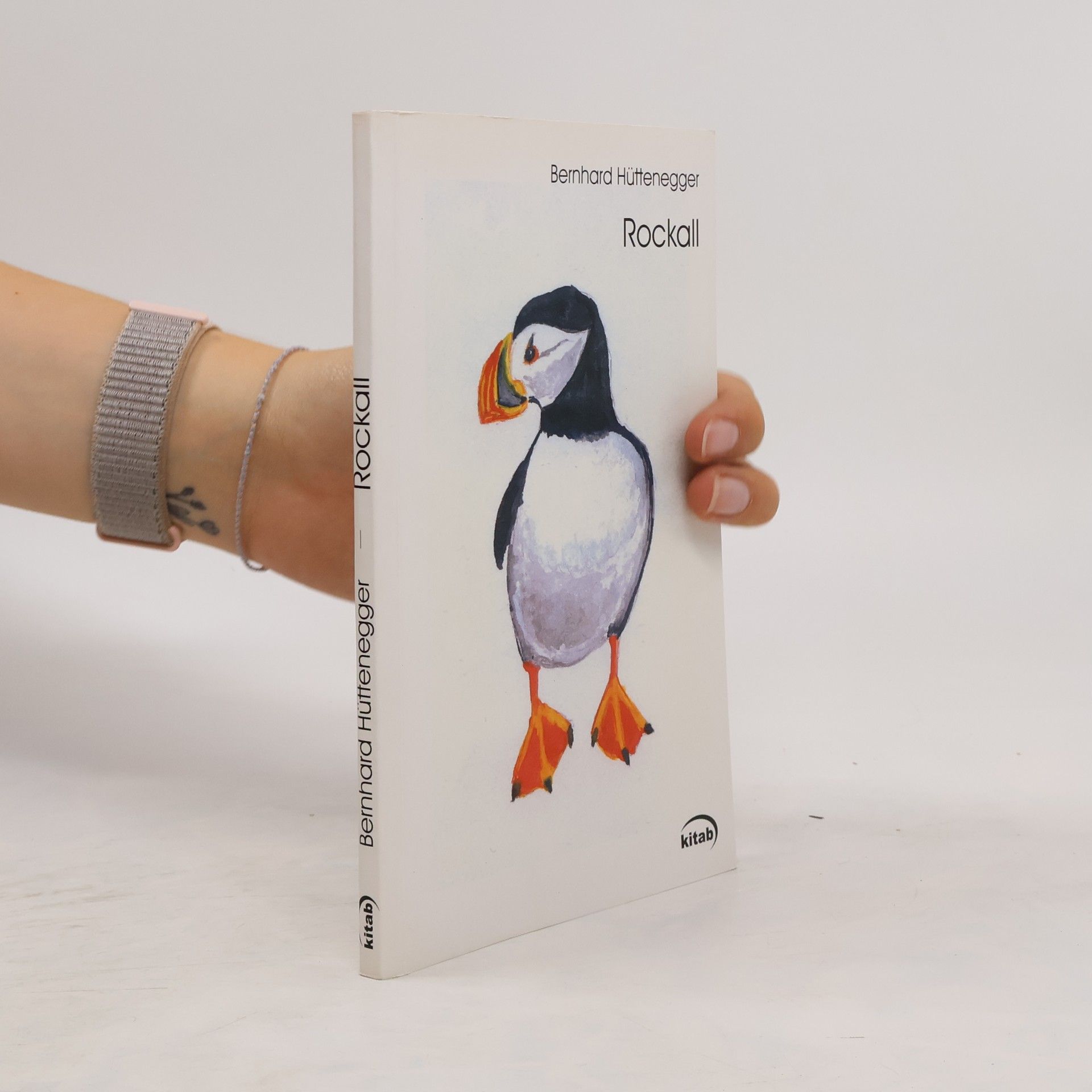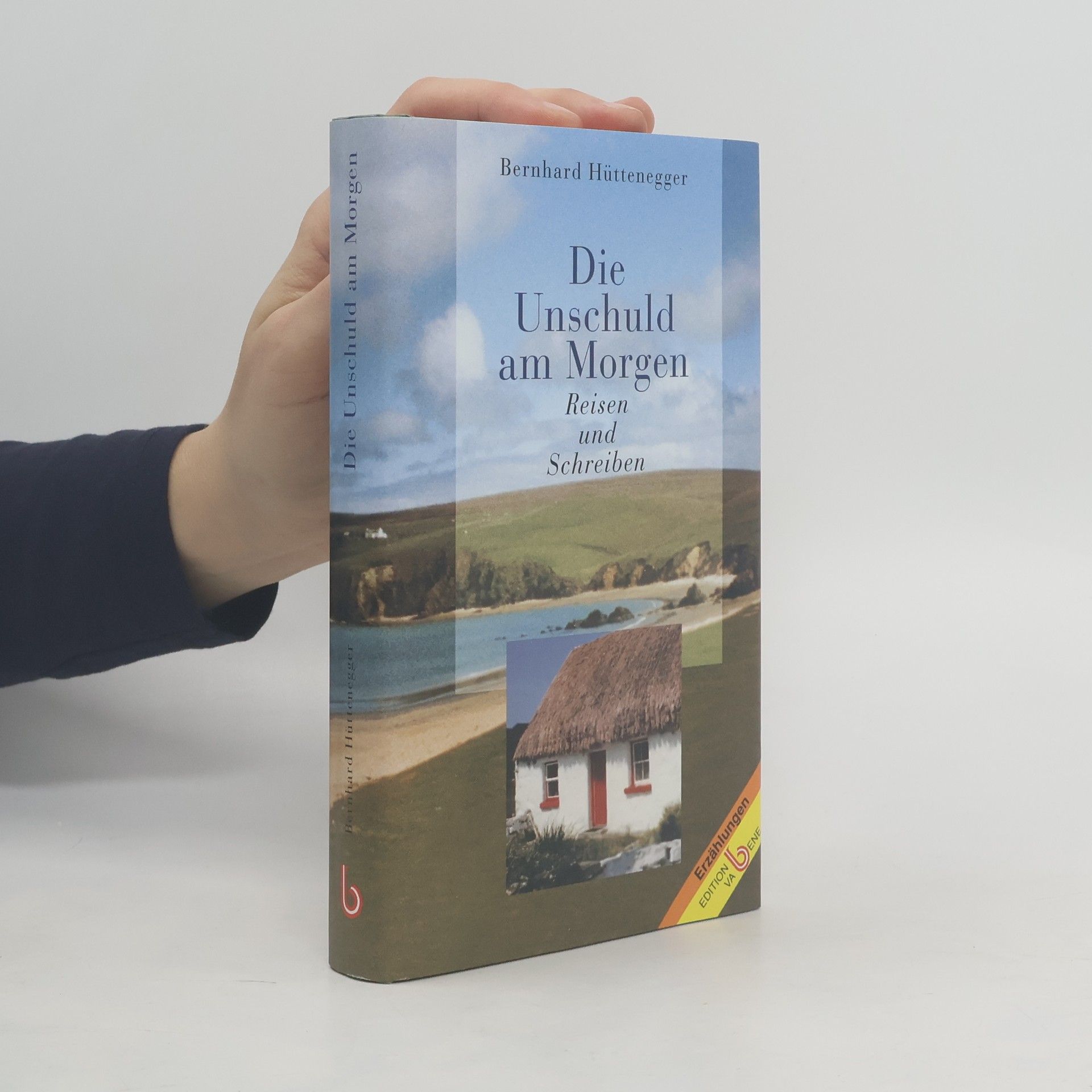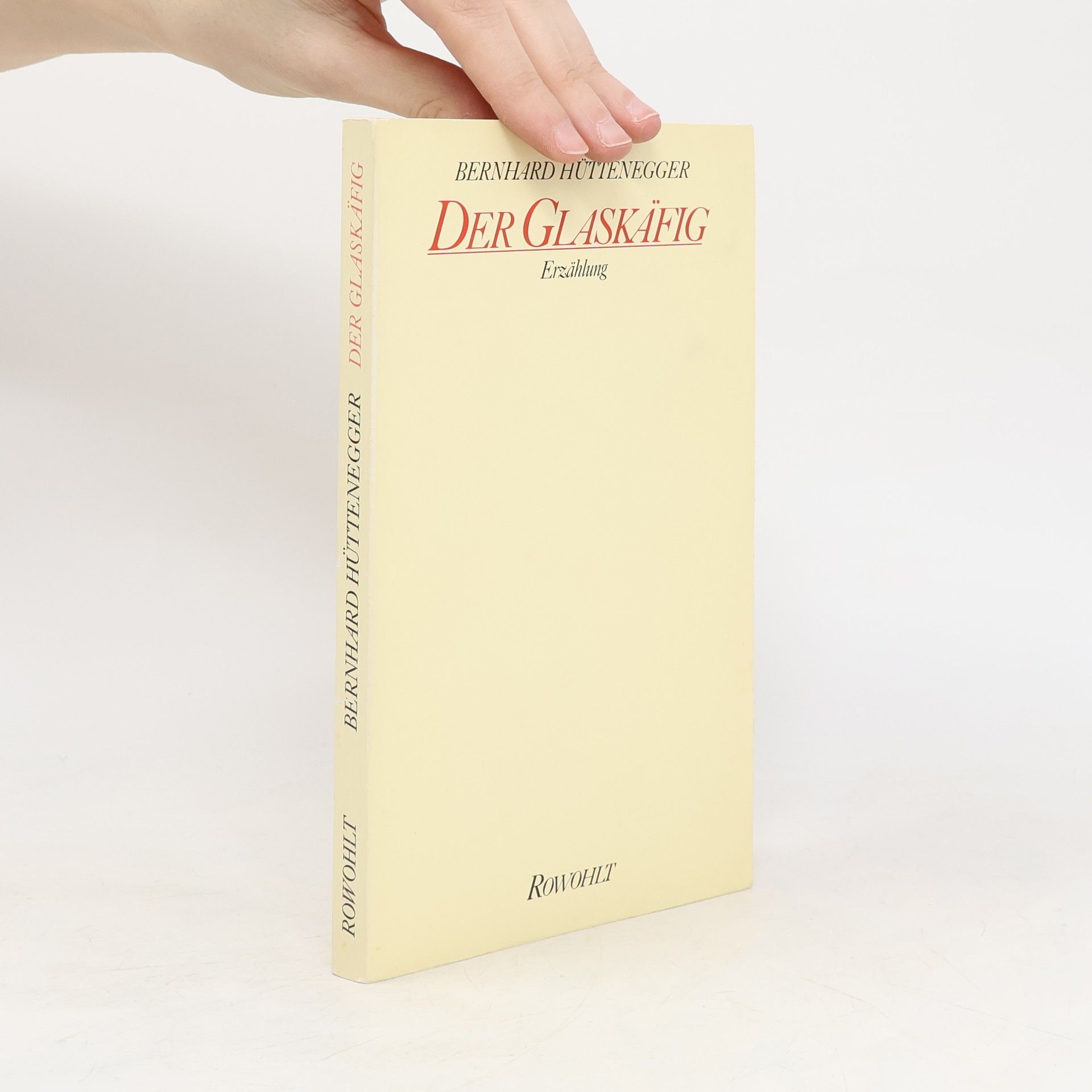Wer seinen Sohn liebt
Erzählung
Ausgeliefert einem unberechenbaren Vater, lernt das Kind, auf die feinsten Irritationen zu reagieren. Sensibel nimmt der Bub alles wahr, was um ihn geschieht. Die Herzlosigkeit der Menschen nach dem Krieg, die Flucht in platte Sätze und in Rollen, die jeden knechten. Auch den Vater. Das lernt der Sohn irgendwann verstehen. Dazwischen sucht der Bub seinen Freiraum, indem er alles willkommen heißt, was ihn von diesem dumpfen Leben ablenkt: die Spinnen, die er auf dem Abort füttert, die Skispringer, die er alle mit Namen kennt, die Freude über jedes Wort, mit dem er seine Welt nachzeichnen kann. Und schließlich der Tod. Dadurch, dass der Sohn das Sterben des Vaters schmerzlich genau beschreibt, befreit er sich selbst aus der Erschütterung über das Leben mit dem Vater.