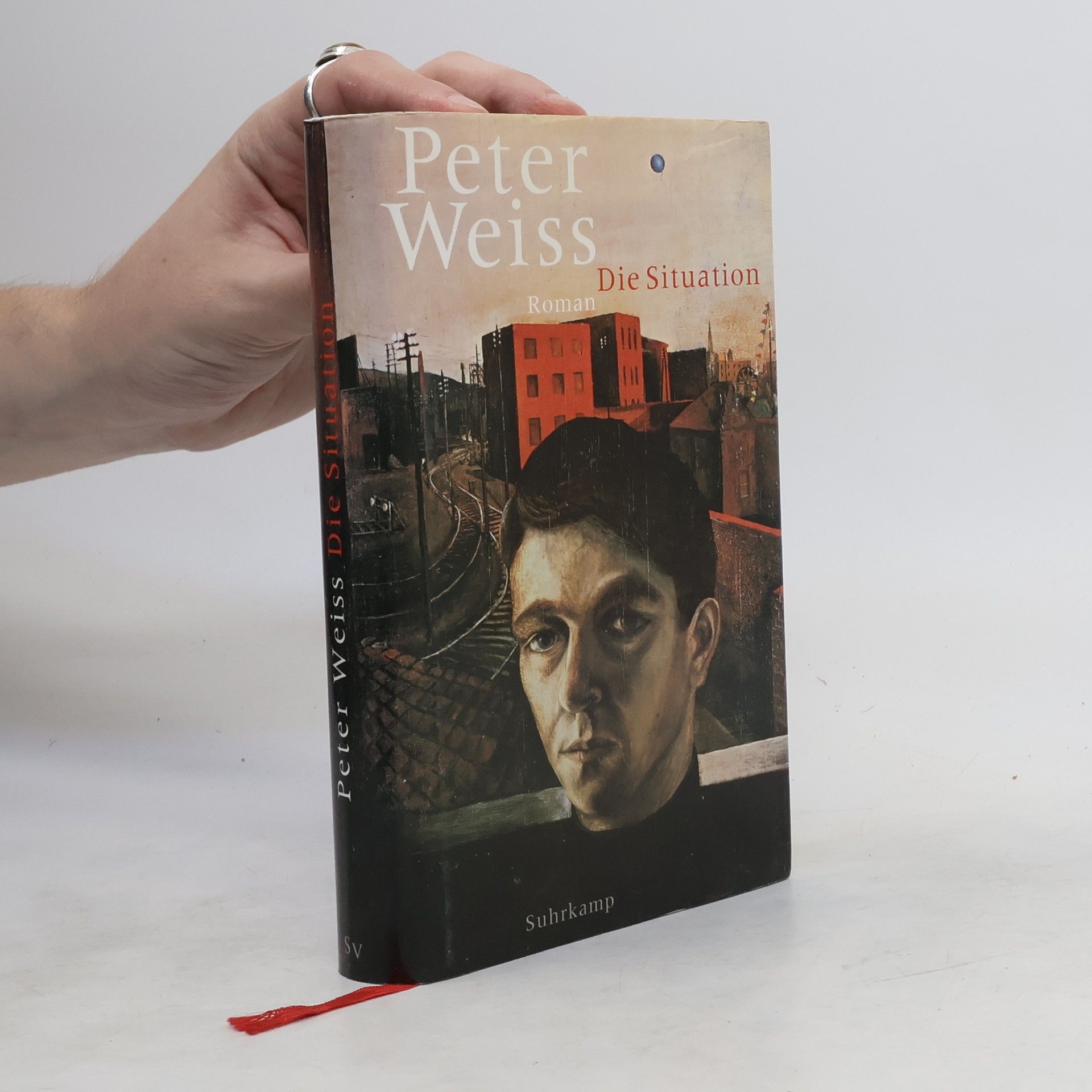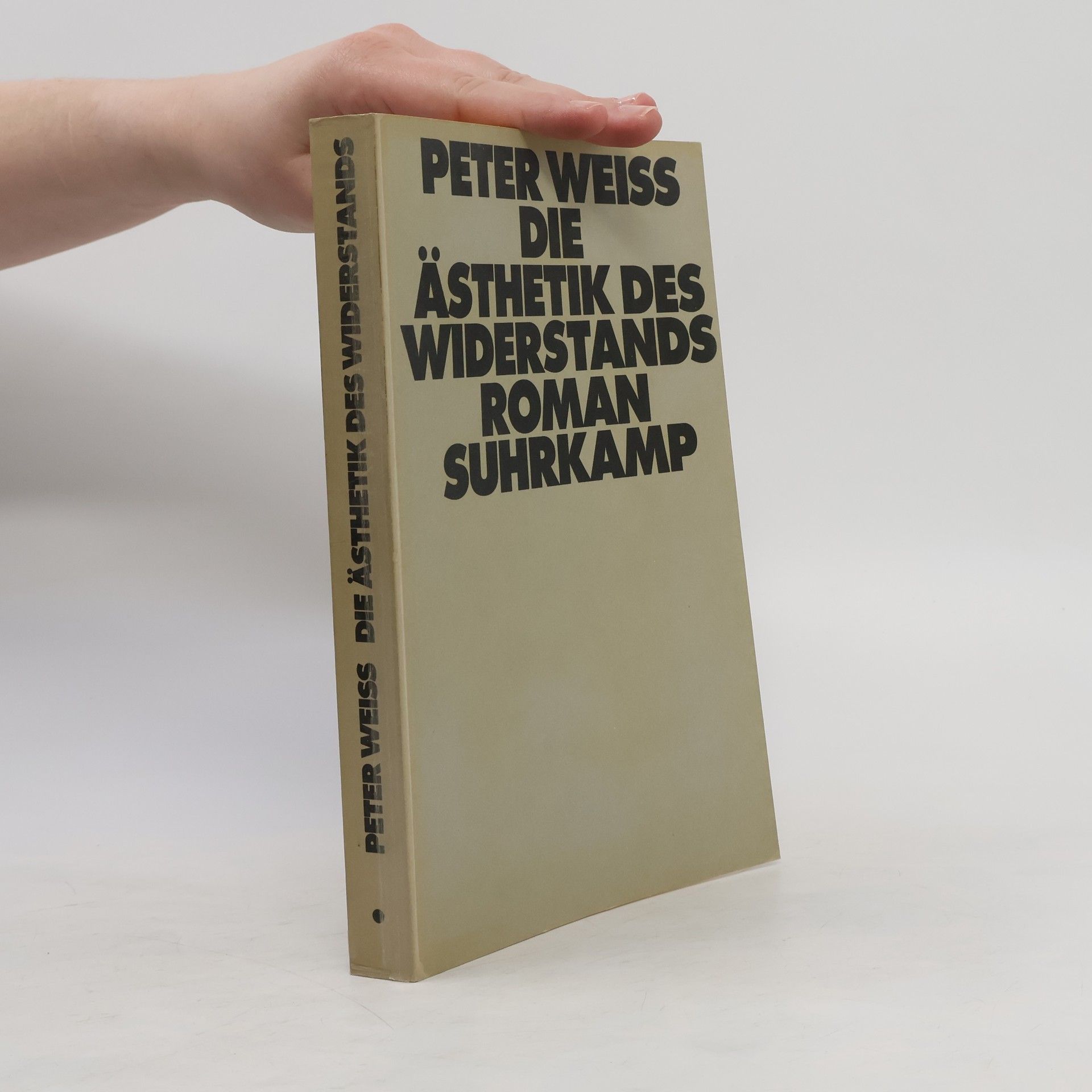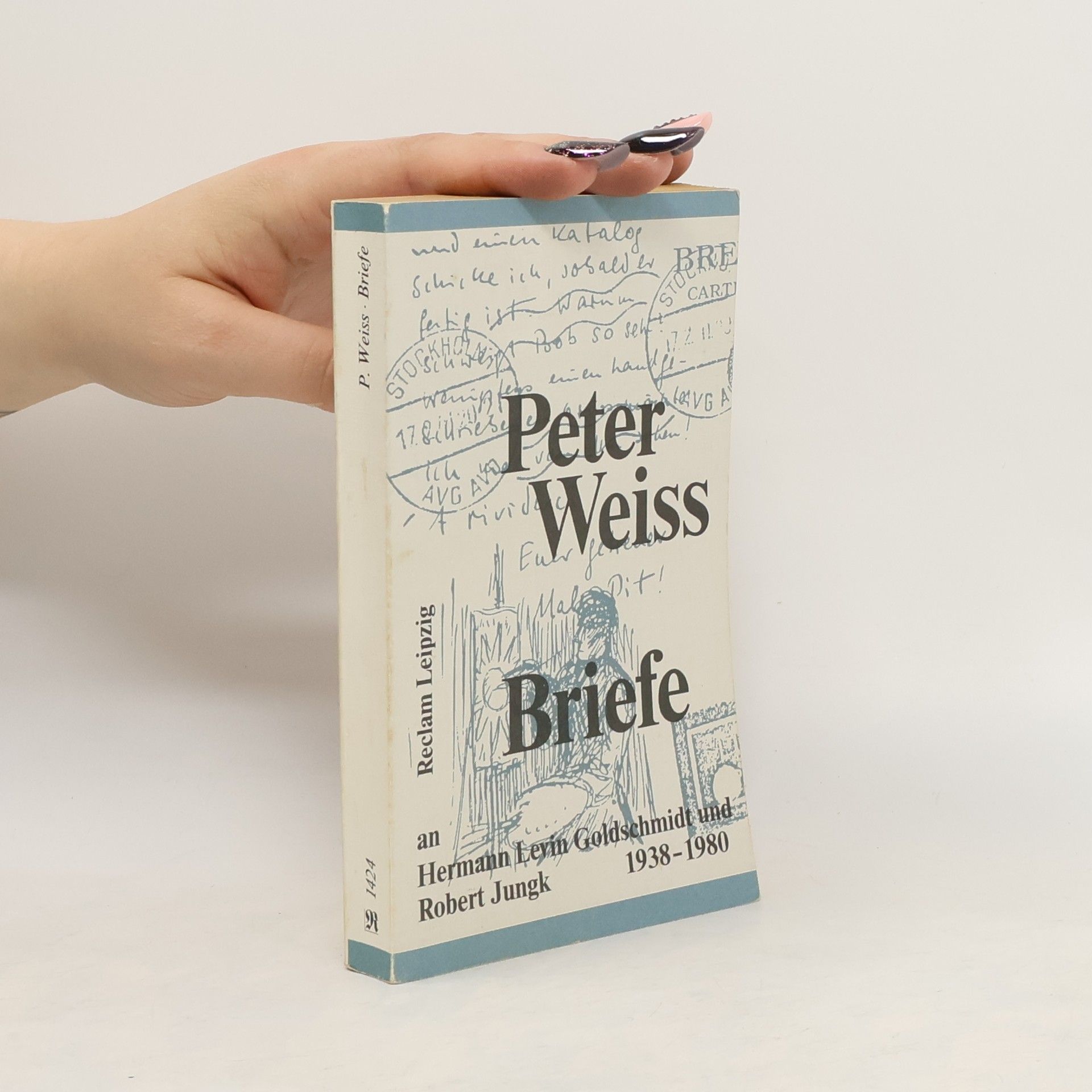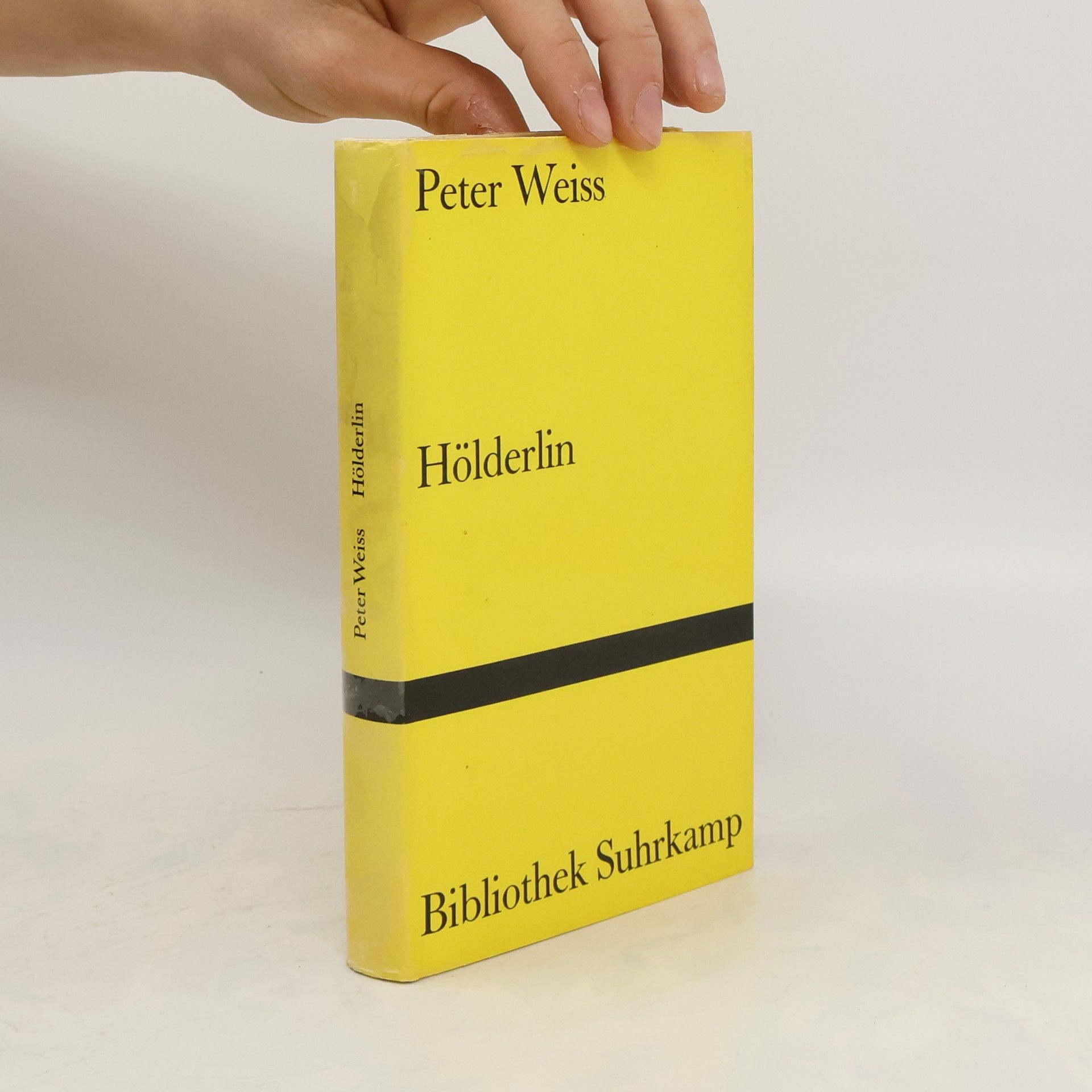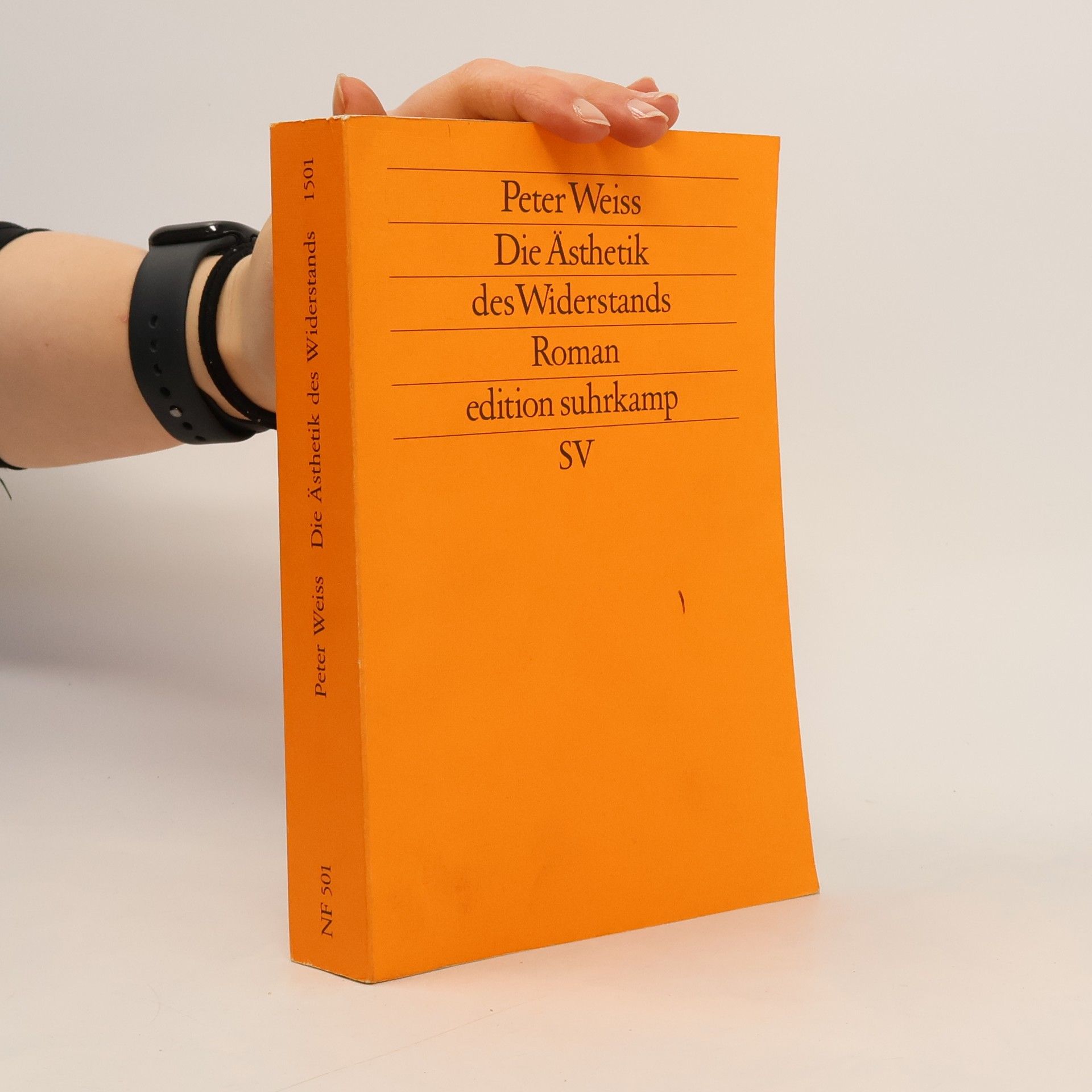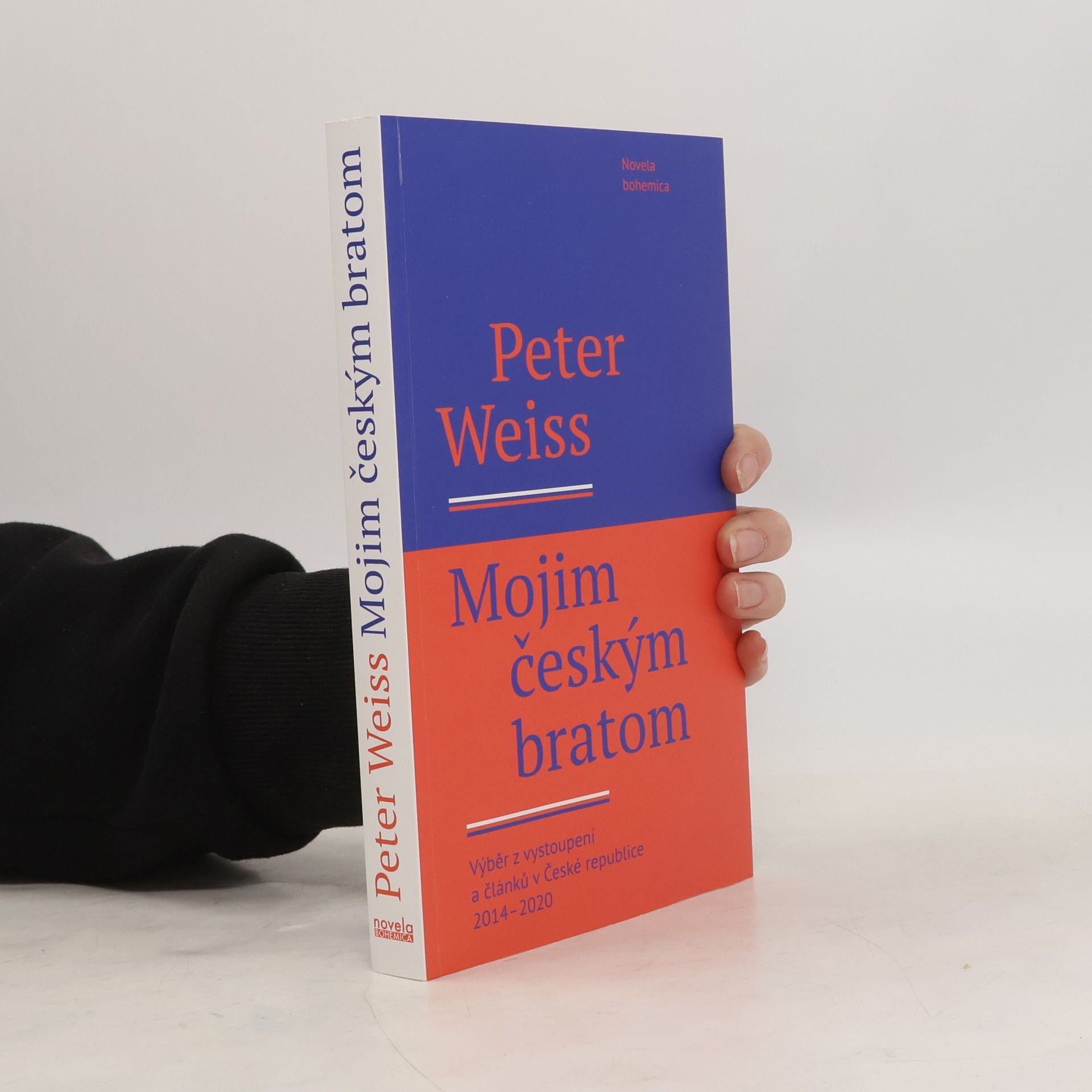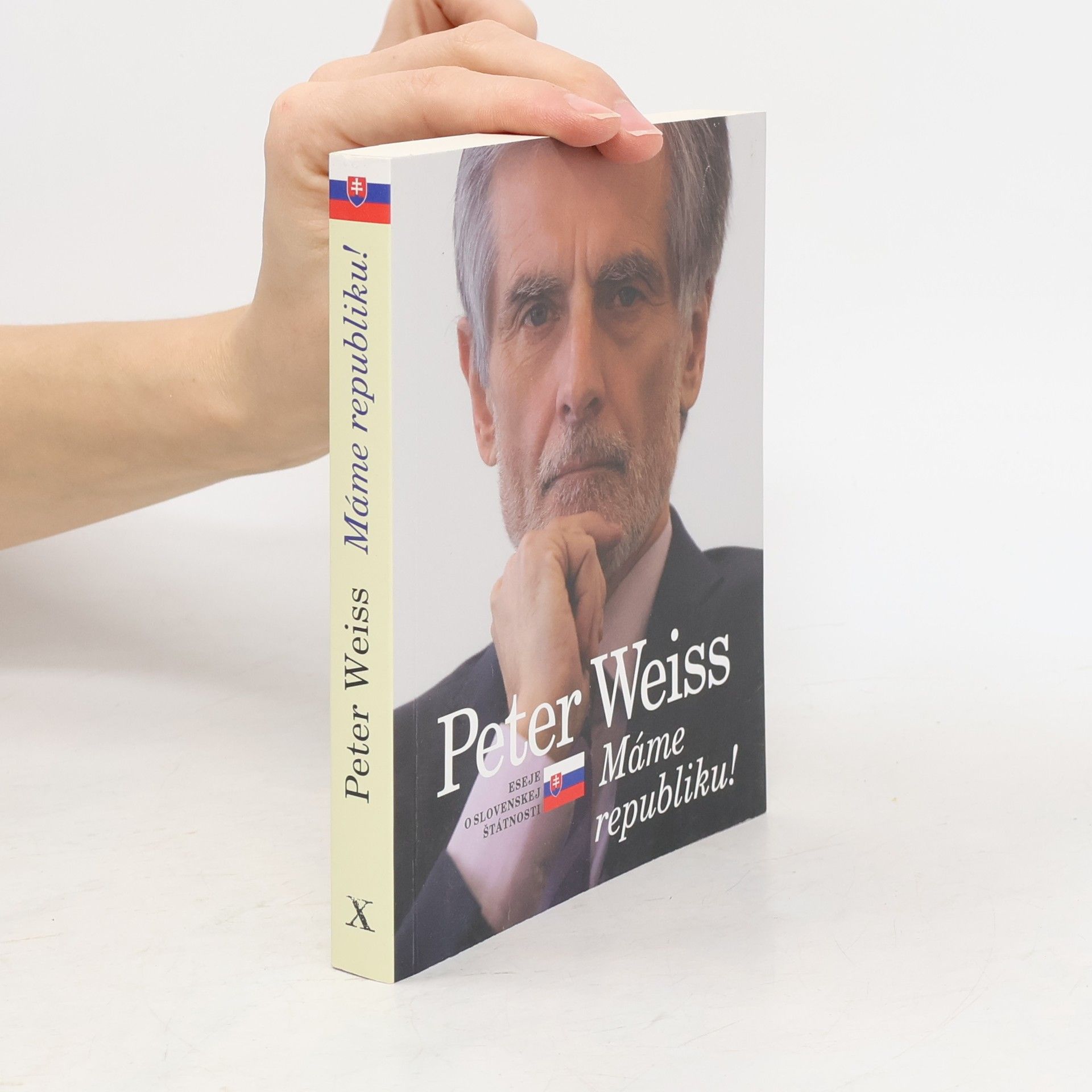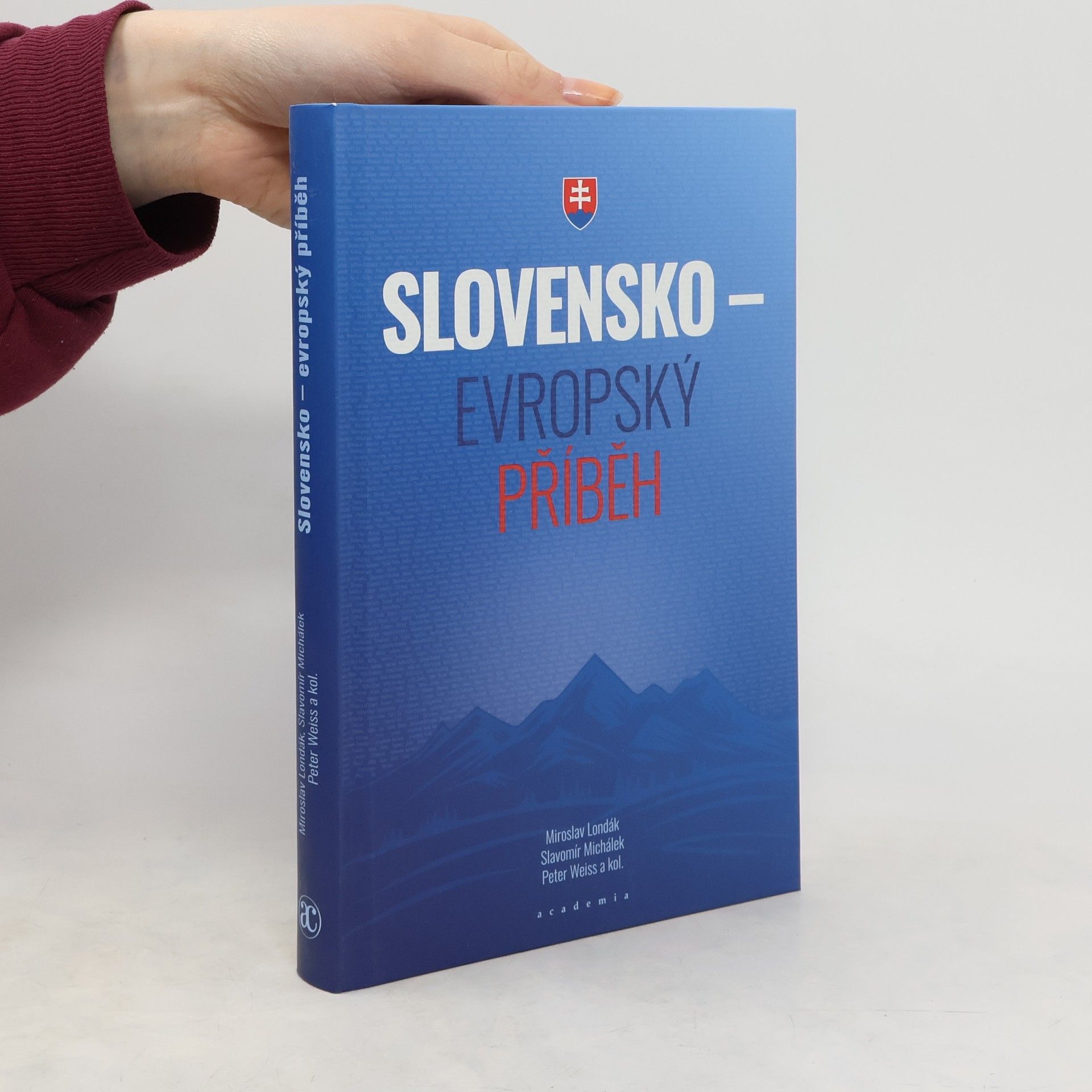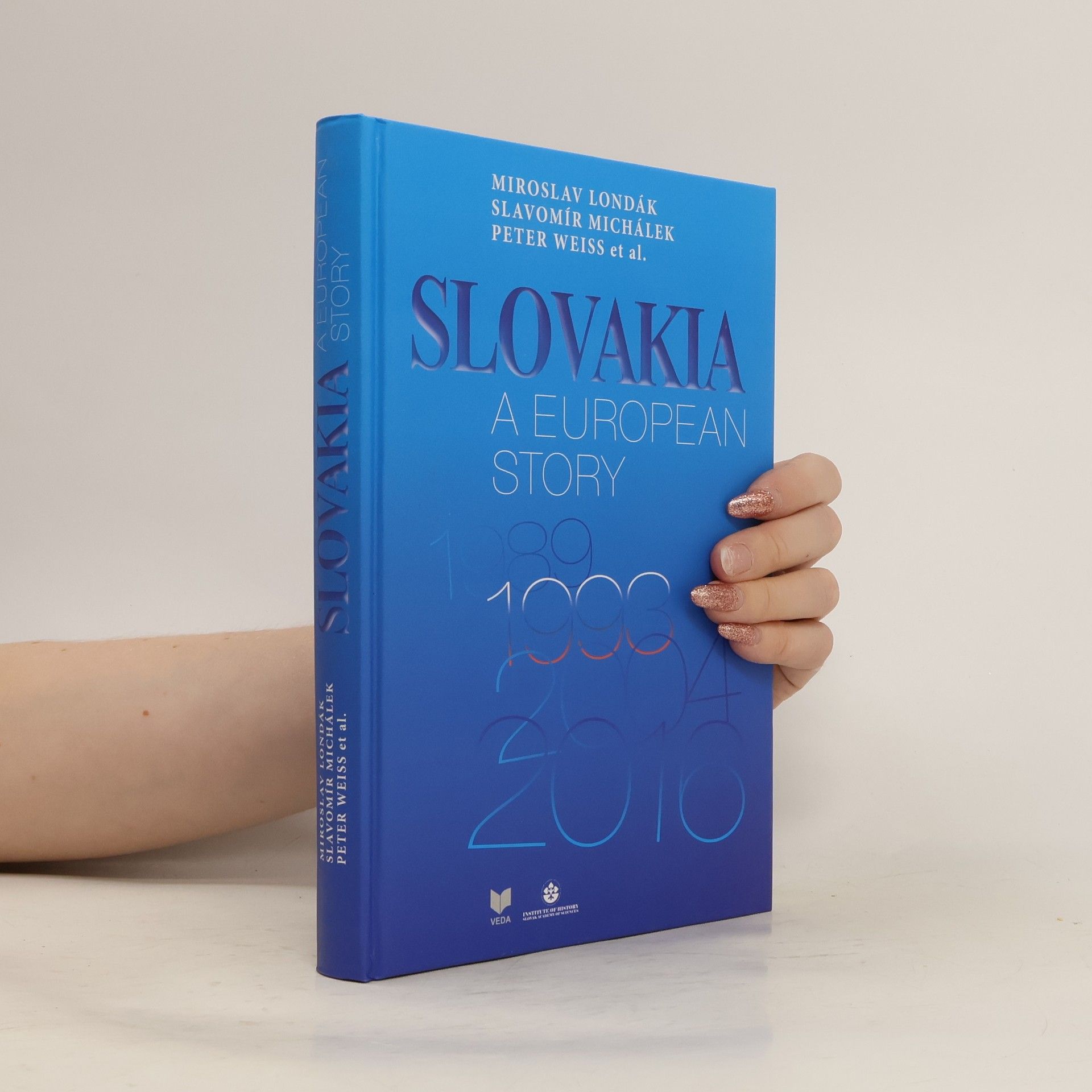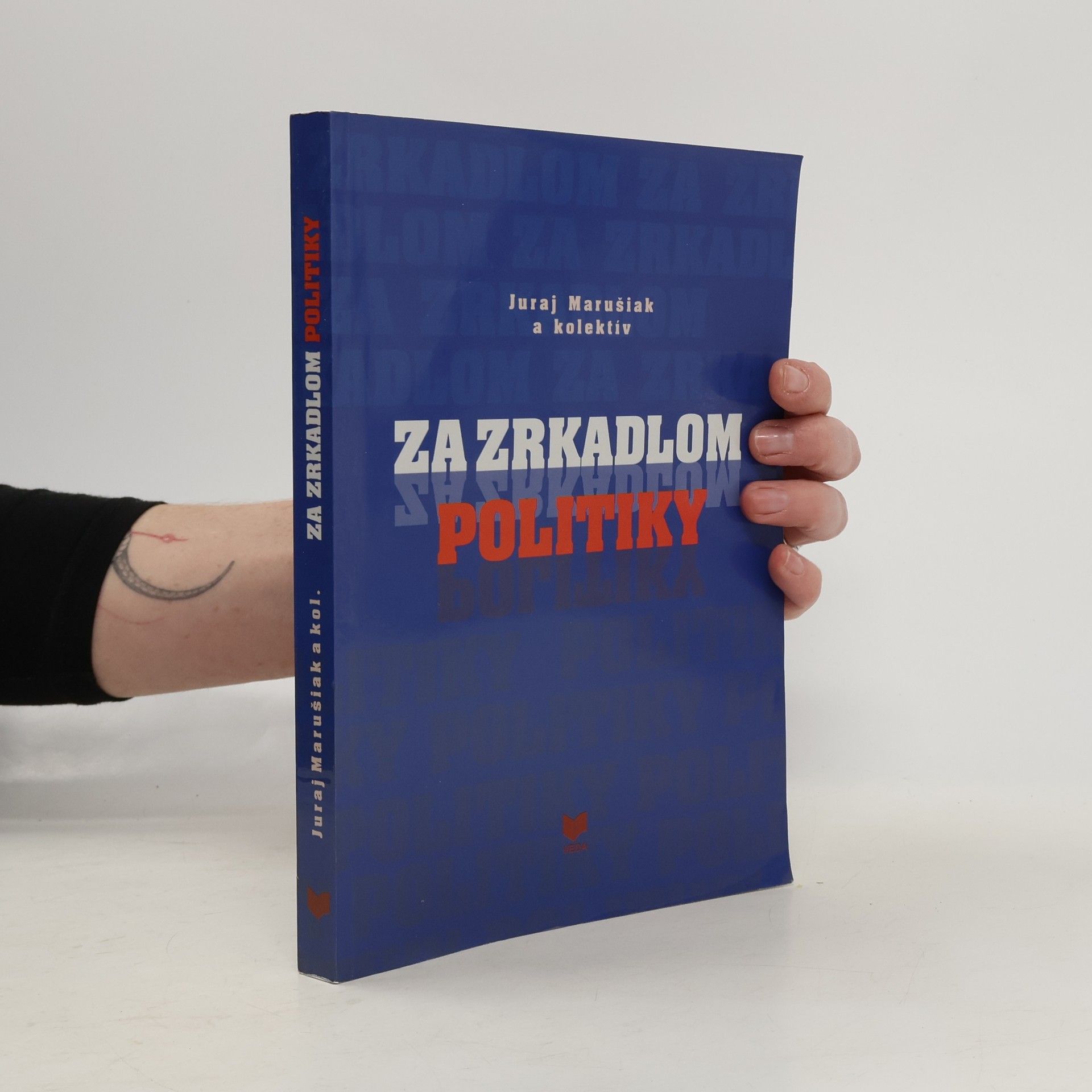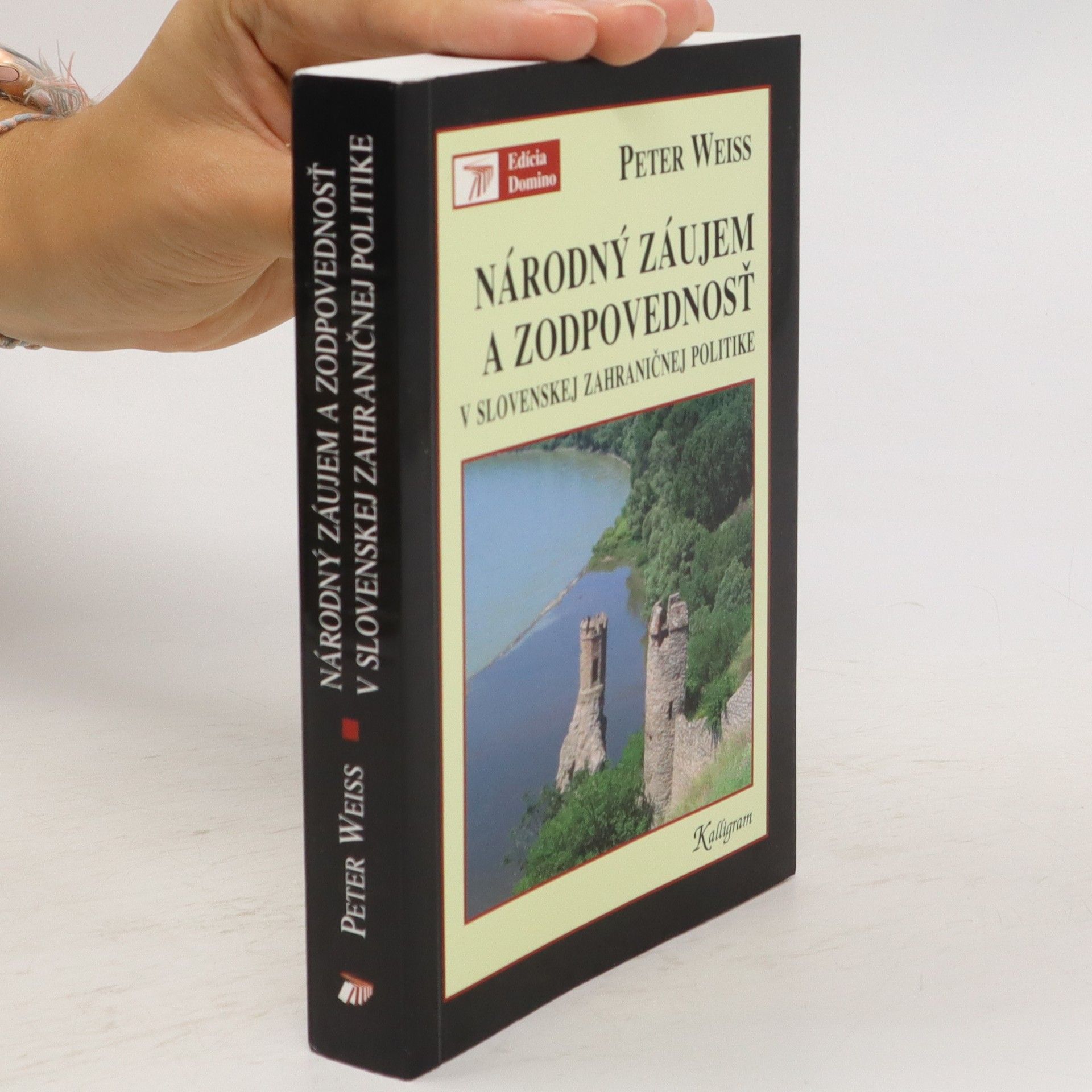Clementis & Mináč: Vlastenci alebo "buržoázni nacionalisti"?
- 300 Seiten
- 11 Lesestunden
Tento 300 stranový text obsahuje unikátne výpovede, spomienky, citáty, štúdie, eseje a komentáre významných osobností spoločenského života, vrátane akademikov a spisovateľov, ako aj raritné fotografie z archívov rodiny a priateľov dvoch významných osobností slovenskej kultúry, politiky a literatúry — Vladimíra Clementisa a Vladimíra Mináča. Obe osobnosti sa obetovali pre ideu spravodlivejšej spoločnosti a spájajú ich okrúhle výročia narodenia, silné národné a sociálne cítenie, brilantná esejistika a duch kontinuity národného uvedomenia Slovákov. Kniha je výsledkom zhromaždeného materiálu z viacerých vedecko-odborných a spoločenských podujatí, ako aj textov špeciálne napísaných pre túto publikáciu. Bohatú obrazovú prílohu doplnil Dr. L. Skrak, pričom originálne kresby a maľby vytvorili M. Kvašňovská a T. Klimek. Archívne fotografie dodali aj ďalší prispievatelia. Zostavovateľmi sú Dr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej a Dr. Lukáš Perný, pracovník Slovenského literárneho ústavu a kulturológ.