Karl Siegbert Rehberg Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
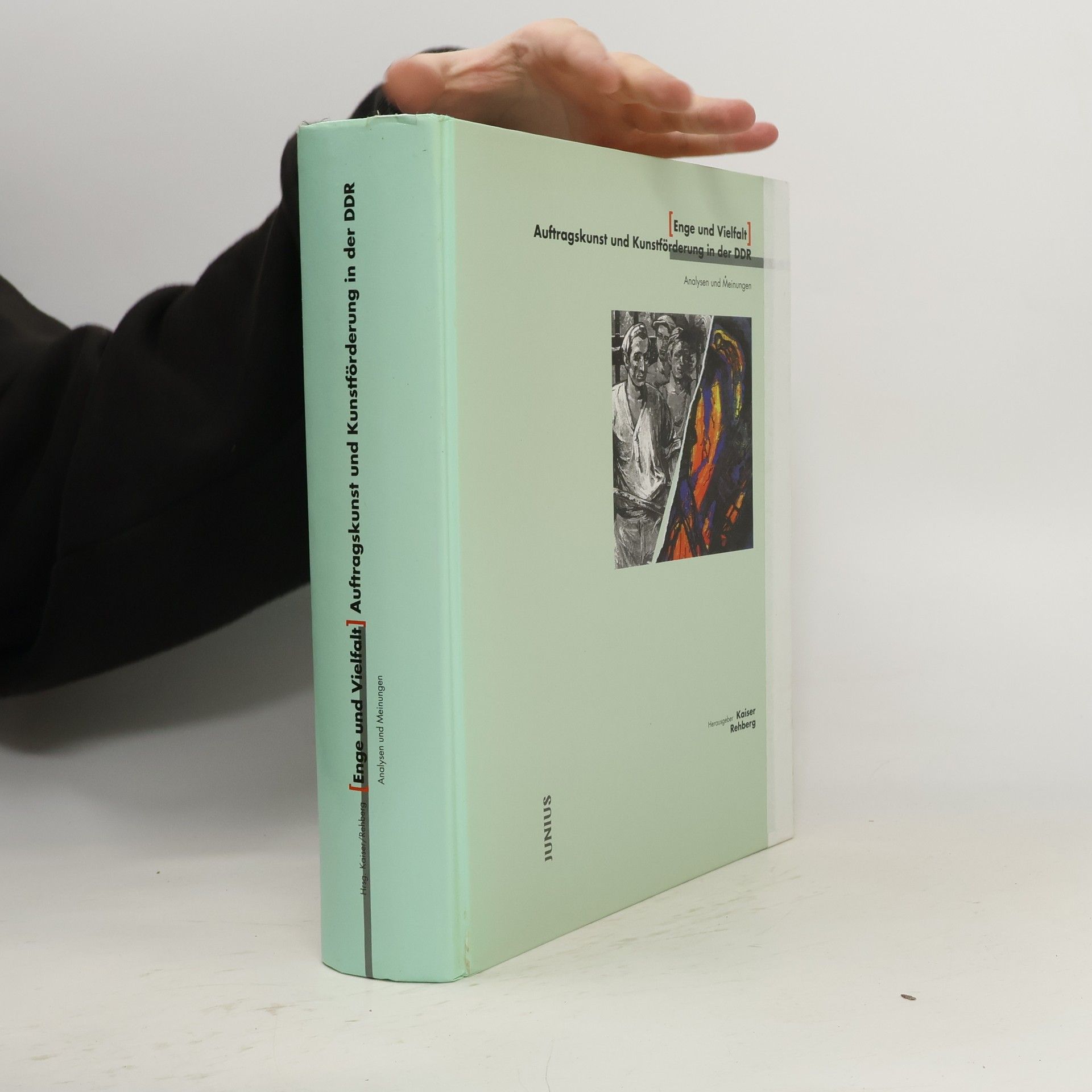
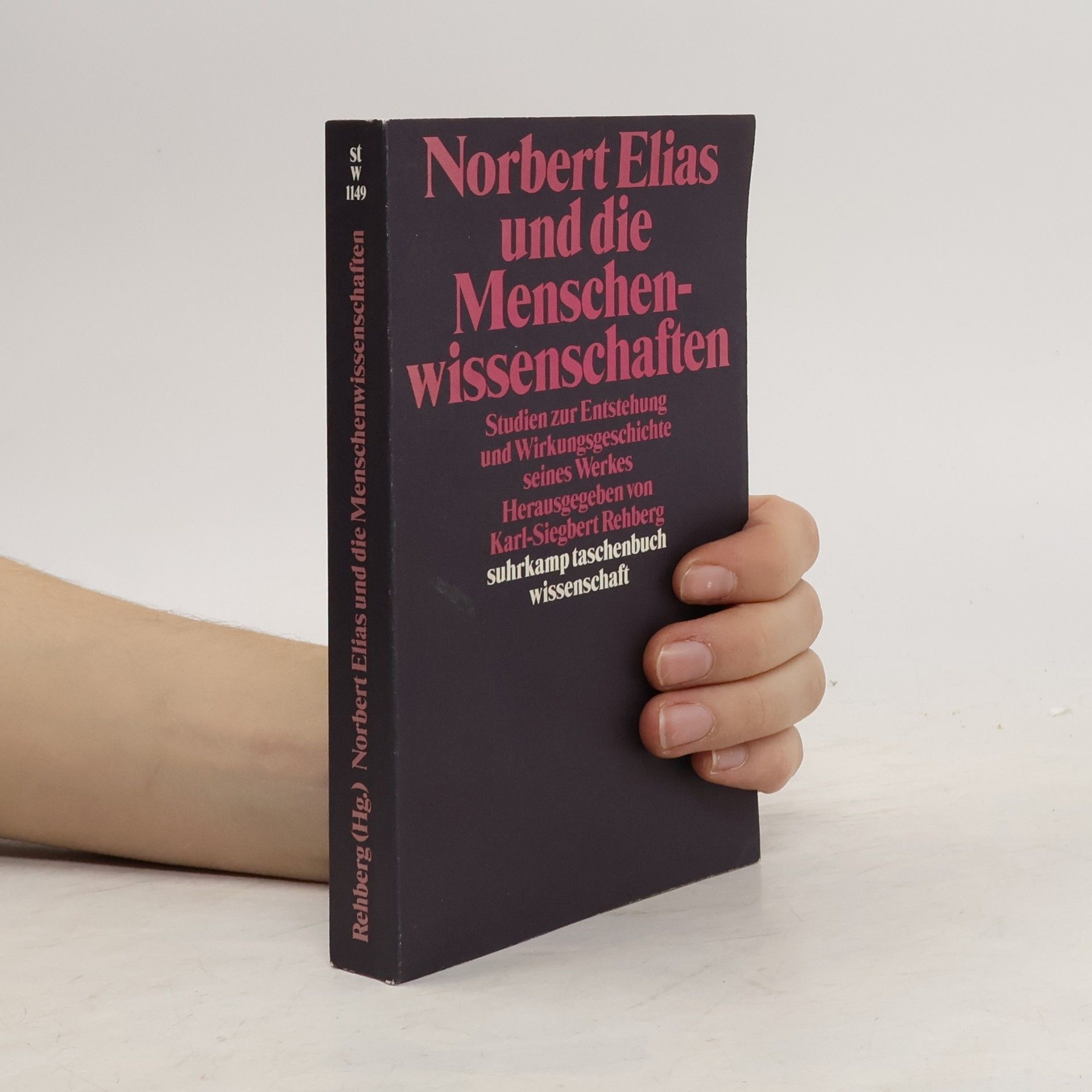
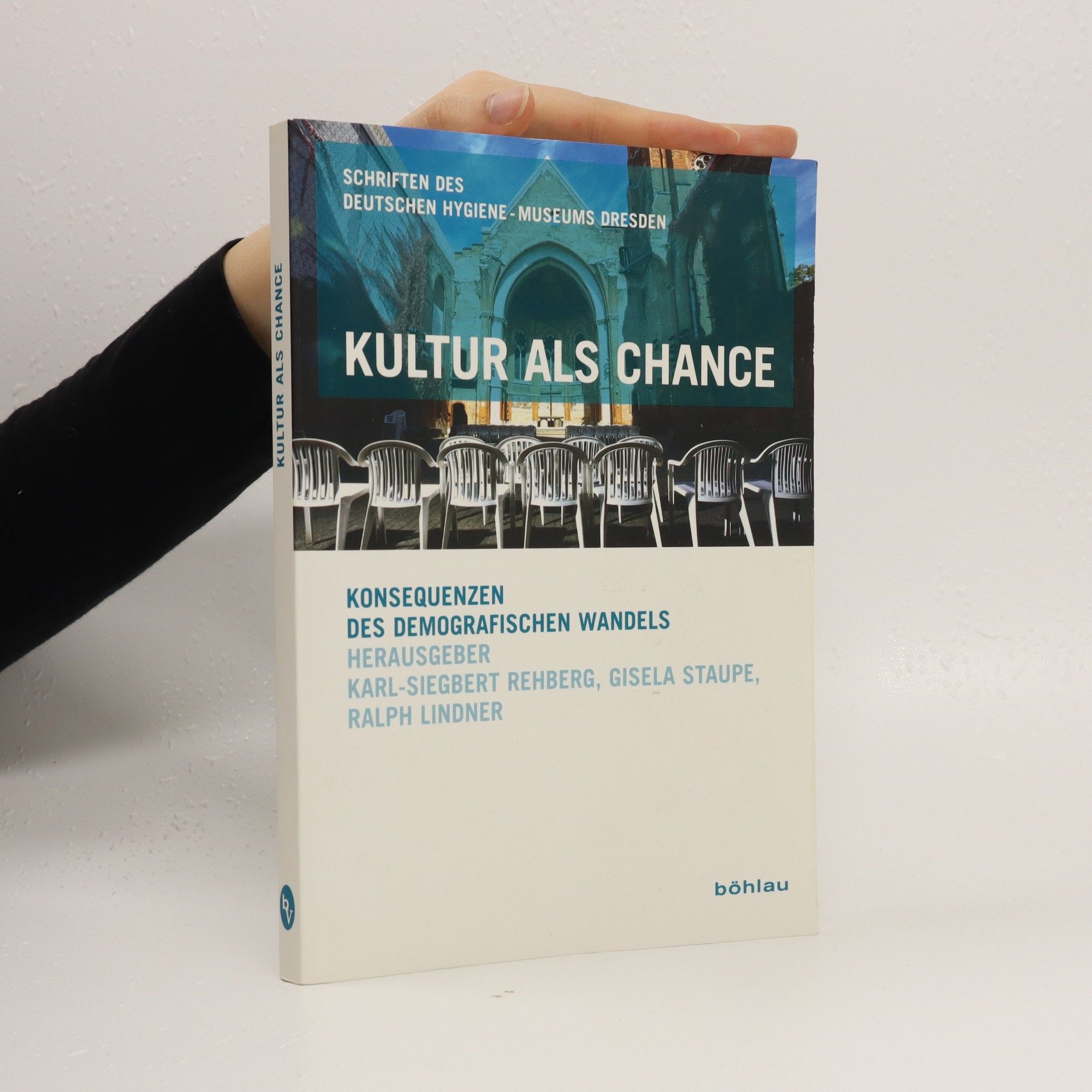
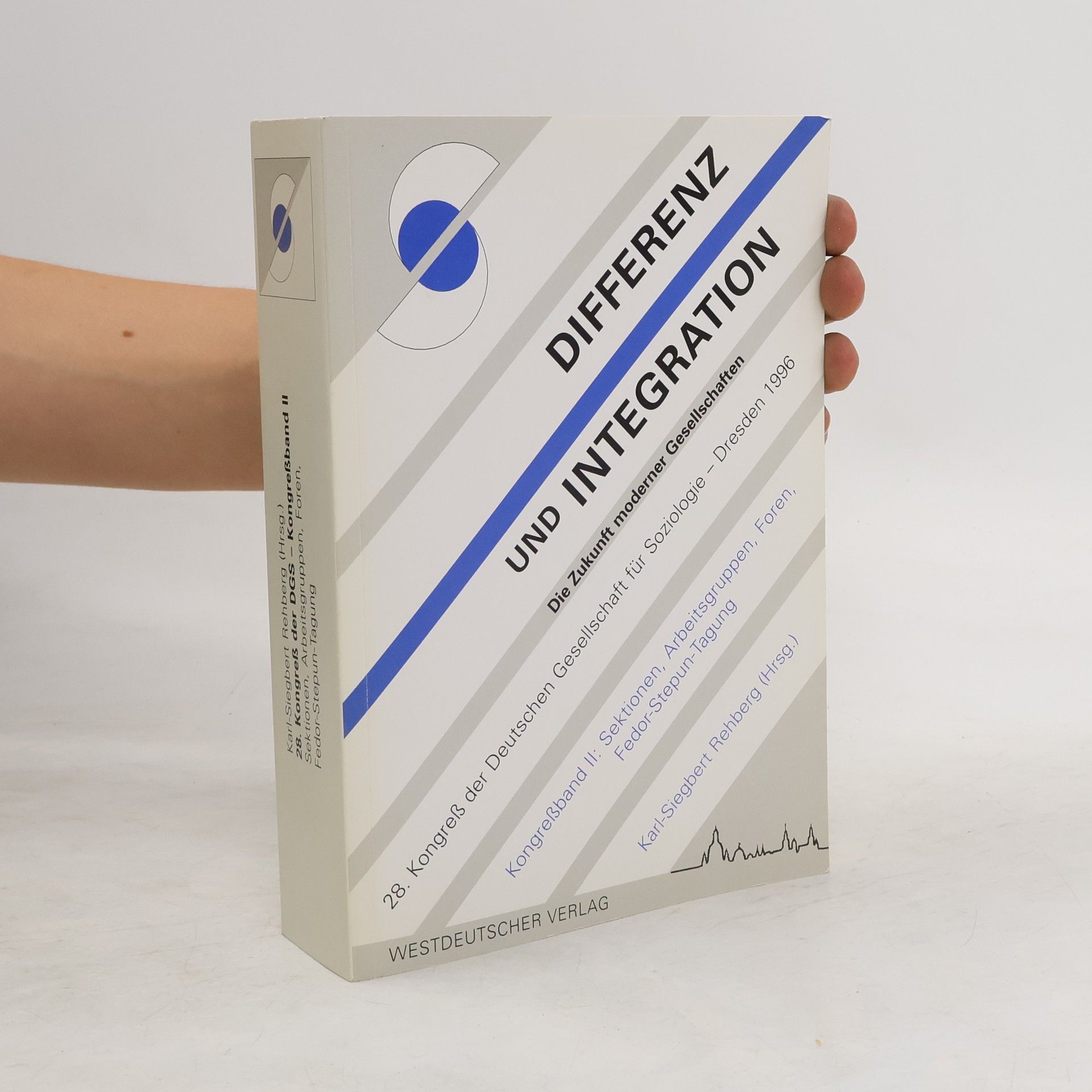
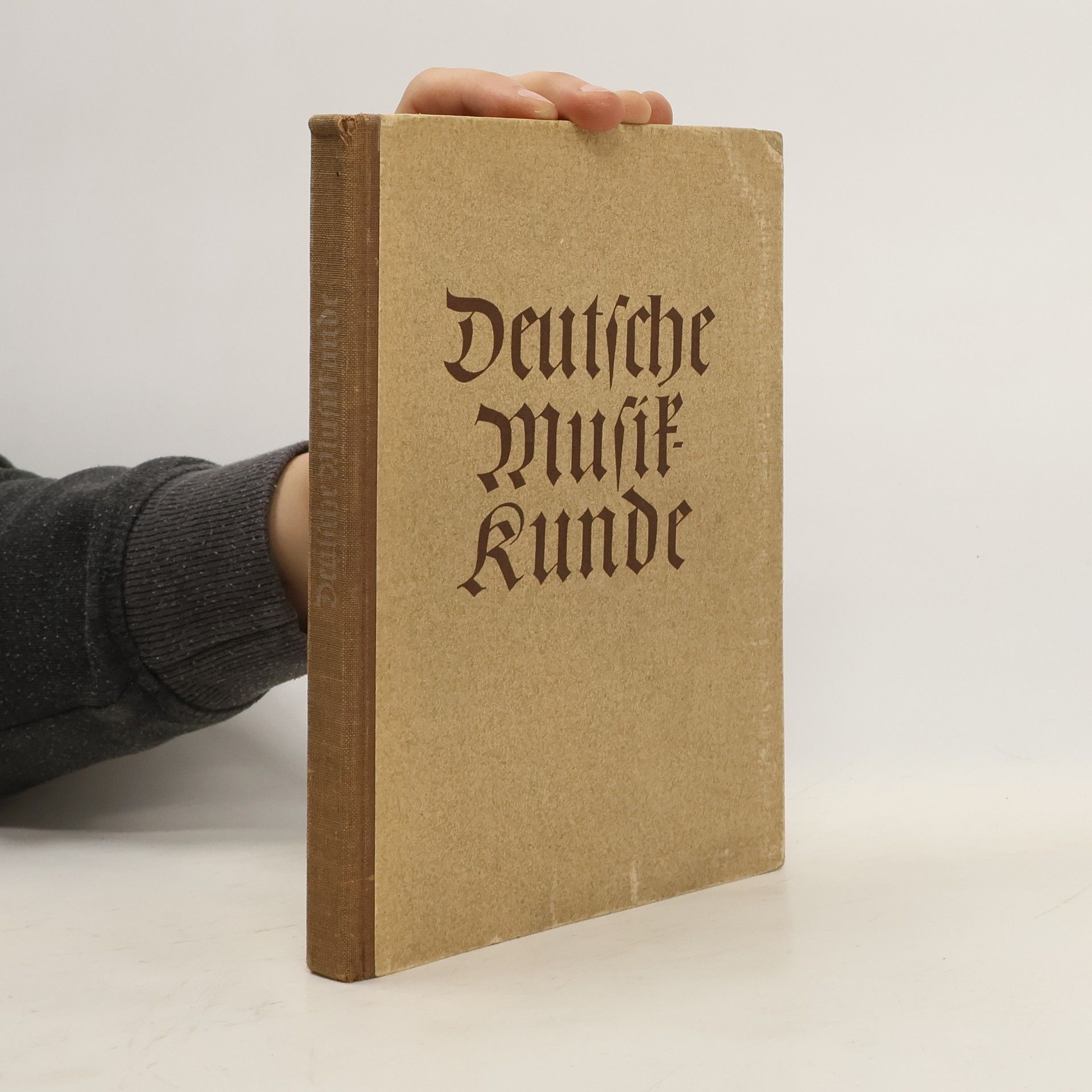
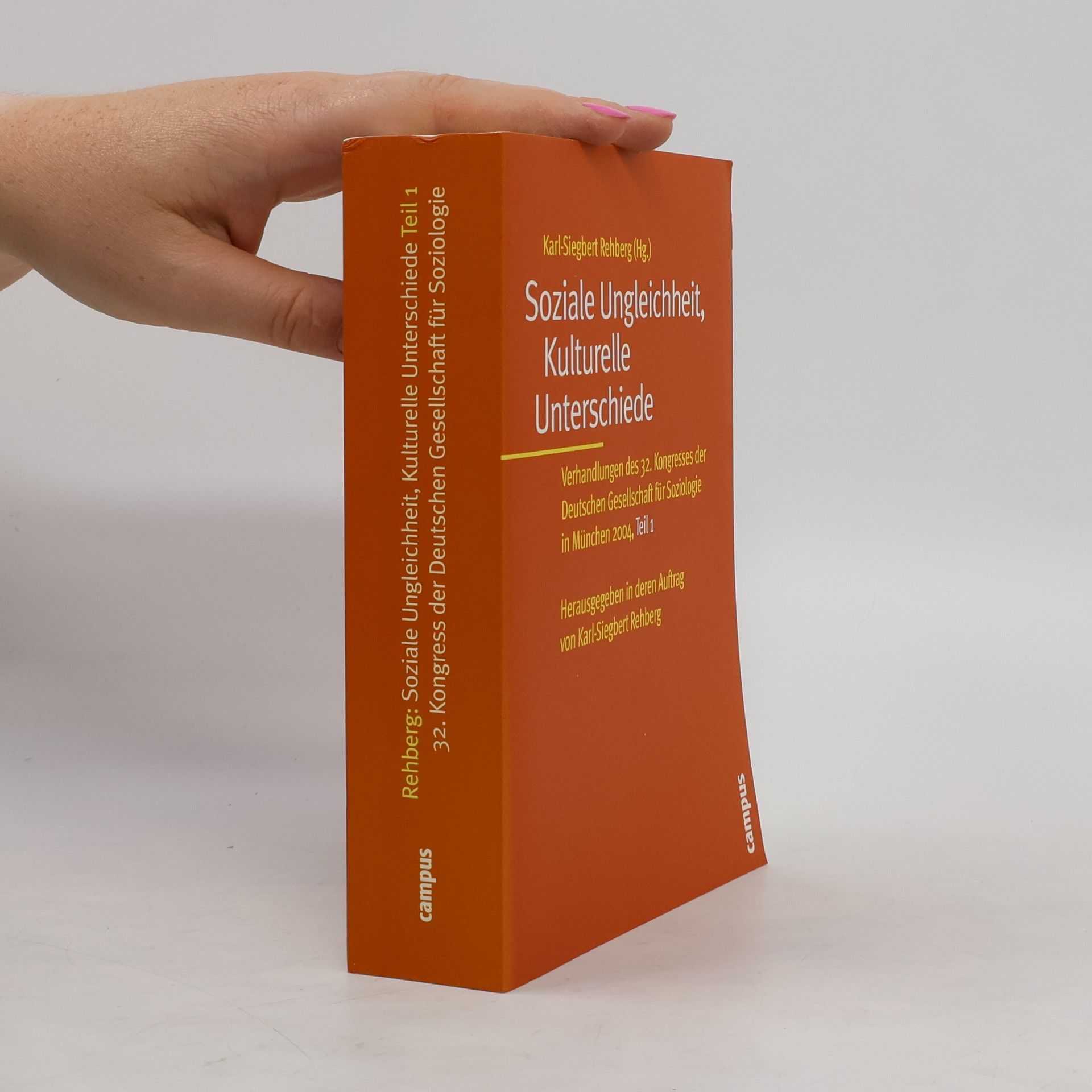
Enge und Vielfalt
Auftragskunst und Kunstförderung in der DDR : Analysen und Meinungen
Der 28. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der im Oktober 1996 an der Technischen Universität Dresden abgehalten wurde, war dem Rahmenthema "Differenz und Integration: Die Zukunft moderner Gesellschaften" gewidmet. Der vorliegende Kongreßband II veröffentlicht die Beiträge aus den Sitzungen der dreißig Sektionen und Arbeitsgruppen, von fünf Foren und der Fedor-Stepun-Tagung. Neben der Dokumentation des Kongresses wird damit auch ein Überblick über den neuesten Stand soziologischer Themenschwerpunkte und Forschungstrends gegeben.
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft - 1149: Norbert Elias und die Menschenwissenschaften
Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes
- 451 Seiten
- 16 Lesestunden
Das auf Synthesen zielende Werk des Soziologen Norbert Elias ist nicht auf eine soziologische Perspektive eingeengt. Stets suchte er, die Grenzen dieser Disziplin zu überschreiten. Soziologie war für ihn zuallererst dasjenige (selbst-)aufklärerische Unternehmen, das die Sozialmythen menschlicher Gruppen und Gesellschaften wichtig nimmt, ihnen aber nicht einfach Glauben schenkt. In einer Welt disziplinär aufgespaltener Wissenschaften steht Eliasʼ synthetisierendes Werk fremd – und entspricht deren Desideraten doch in besonderer Weise. Vor allem verspricht seine Prozeßtheorie ein wissenschaftliches Verständnis gesellschaftlicher Dynamik nach dem Ende inhaltlich umschriebener Geschichtsphilosophien.