Die Chronik der Leibniz-Sozietät, die 2023 ihr 30-jähriges Jubiläum feierte, bietet einen Rückblick auf ihre Geschichte, Struktur und Leistungen. Sie behandelt die Gründung, Entwicklung und Erfolge der Gelehrtengesellschaft sowie deren Mitglieder und dokumentiert wichtige Ereignisse und Projekte der letzten drei Jahrzehnte.
Gerhard Banse Bücher
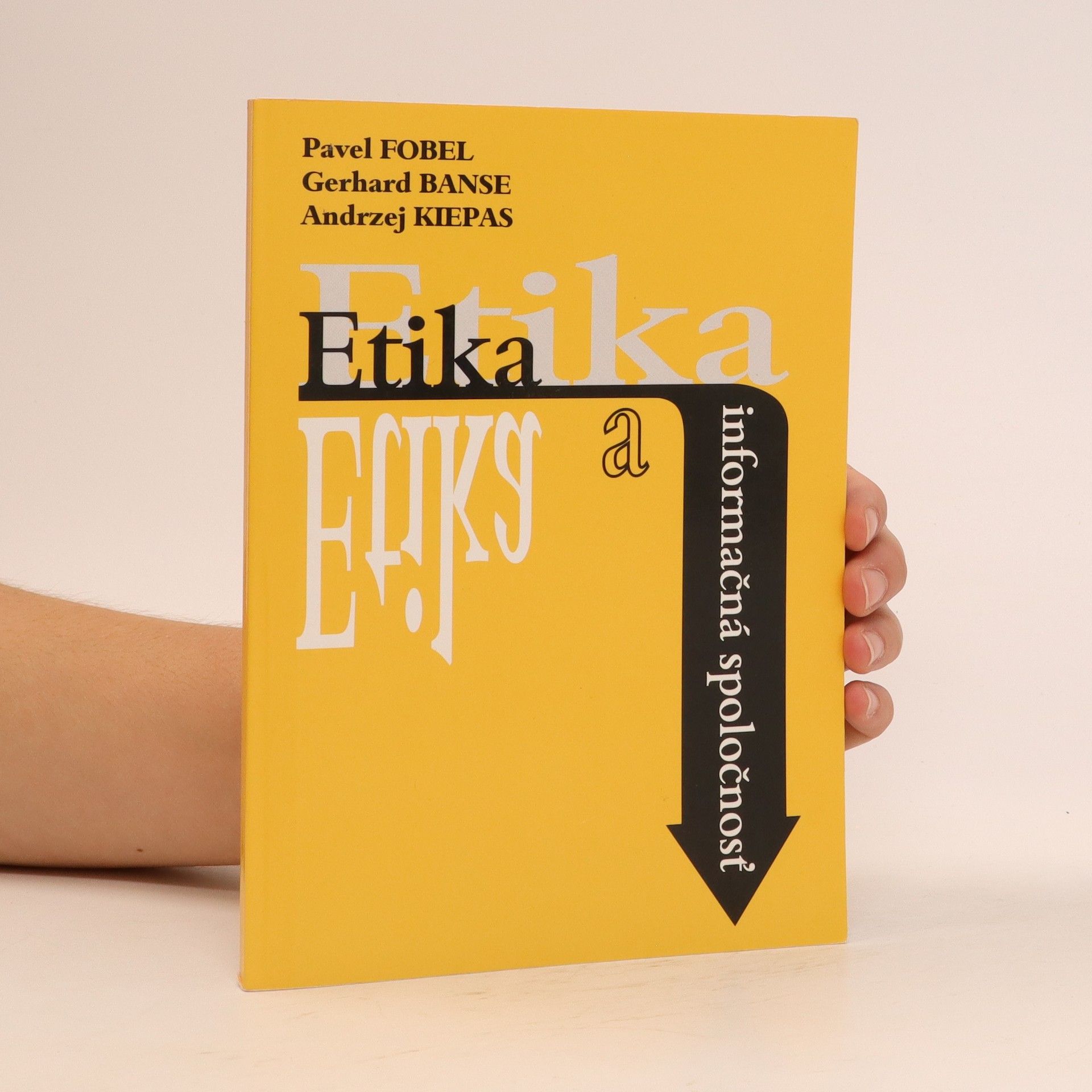
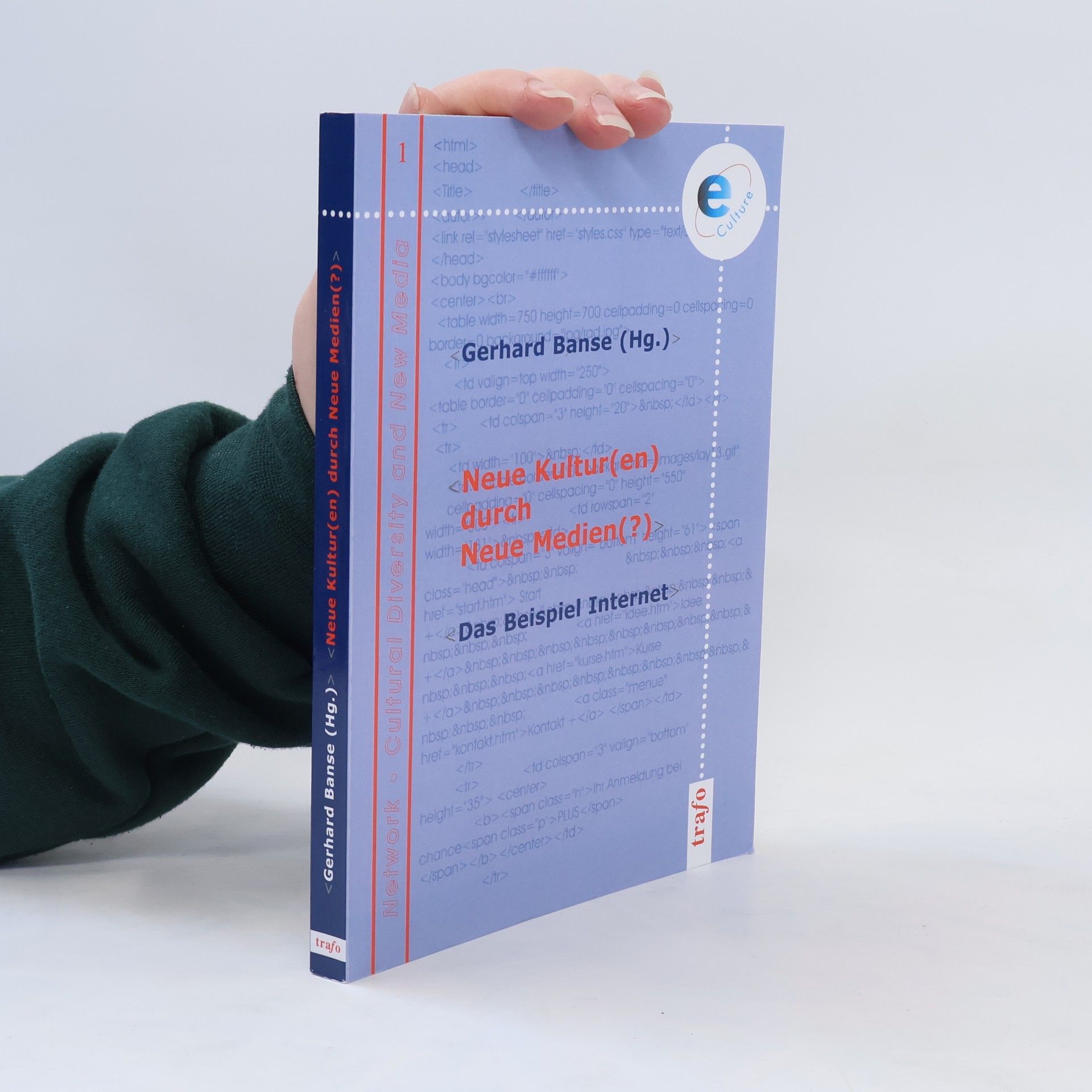
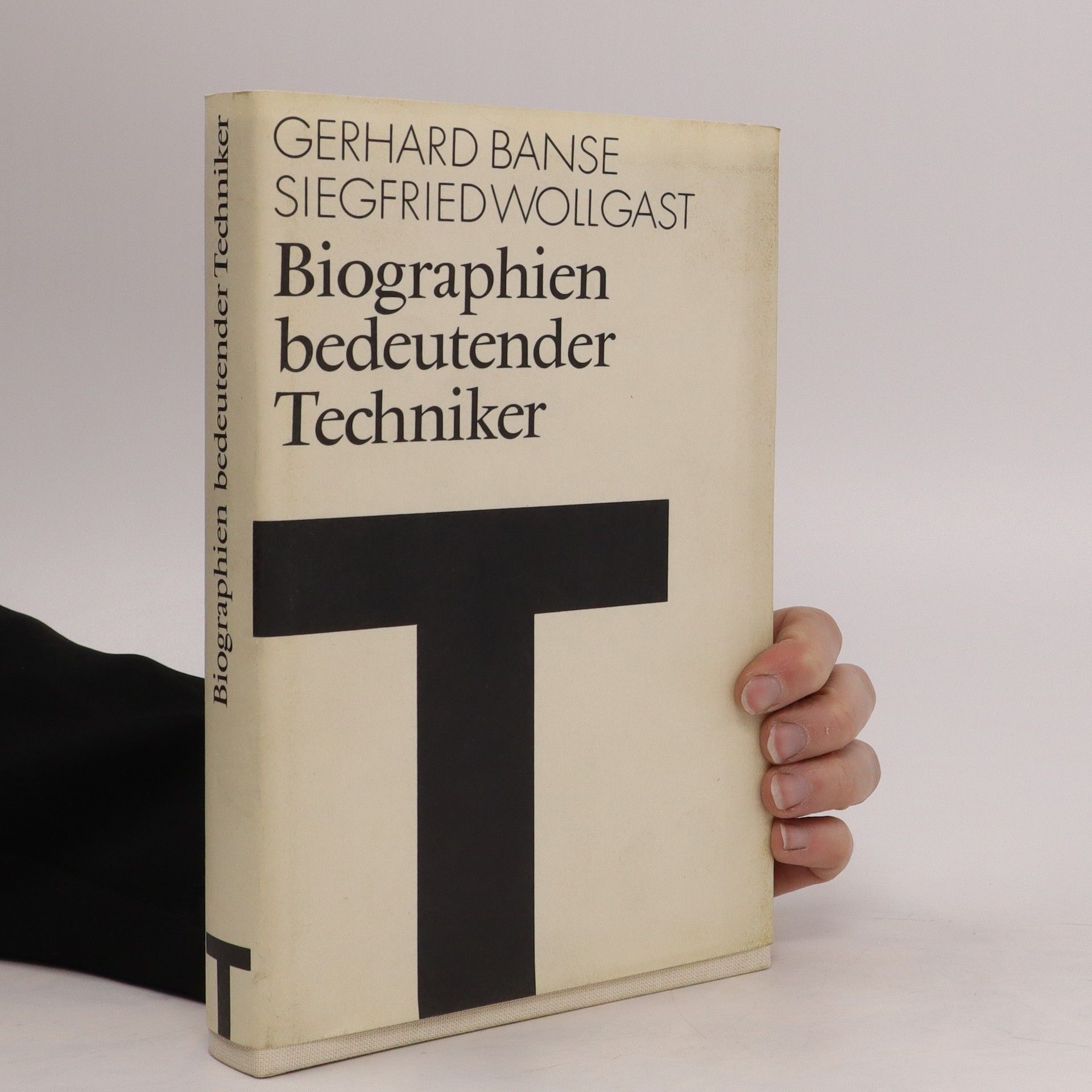

Biographien bedeutender Techniker, Ingenieure und Technikwissenschaftler
- 367 Seiten
- 13 Lesestunden
Neue Kultur(en) durch neue Medien(?)
- 183 Seiten
- 7 Lesestunden
Wenn heute von den so genannten „Neuen Medien“ die Rede ist, dann stehen meistens technische und ökonomische Aspekte im Vordergrund. Stichworte sind dann Medientechnik und Medienmarkt. Hinzu kommen rechtliche Fragestellungen, die mit der Technikgestaltung und der Marktregulierung bzw. -deregulierung verbunden sind. Kulturelle Analysen dagegen sind rar, vergleichend-kulturelle noch rarer. Das kann der vorliegende Band zwar auch nicht entscheidend ändern. Er deutet jedoch eine ergebnisträchtige Analyserichtung und – weitergehend – ein interessantes Forschungsprogramm an, das – in den kommenden Jahren schrittweise realisiert – manche Wissensdefizite wird beseitigen helfen. Zunehmend wird deutlich, dass es auch die Interdependenzen zwischen Informations- und Kommunikationstechnik, Individuum, Kultur, Gesellschaft, Politik, Recht und „Umwelt “ generell und in konkreten Teilbereichen aufzudecken gilt, und zwar auch im nationalen Vergleich, unter Berücksichtigung der kulturellen Verschiedenheit europäischer Nationen. Dem zumindest ansatzweise zu entsprechen ist Anliegen der in diesem Band vereinten Beiträge.