Problematik der Menschenrechte
Beiträge zur Politischen Wissenschaft 87


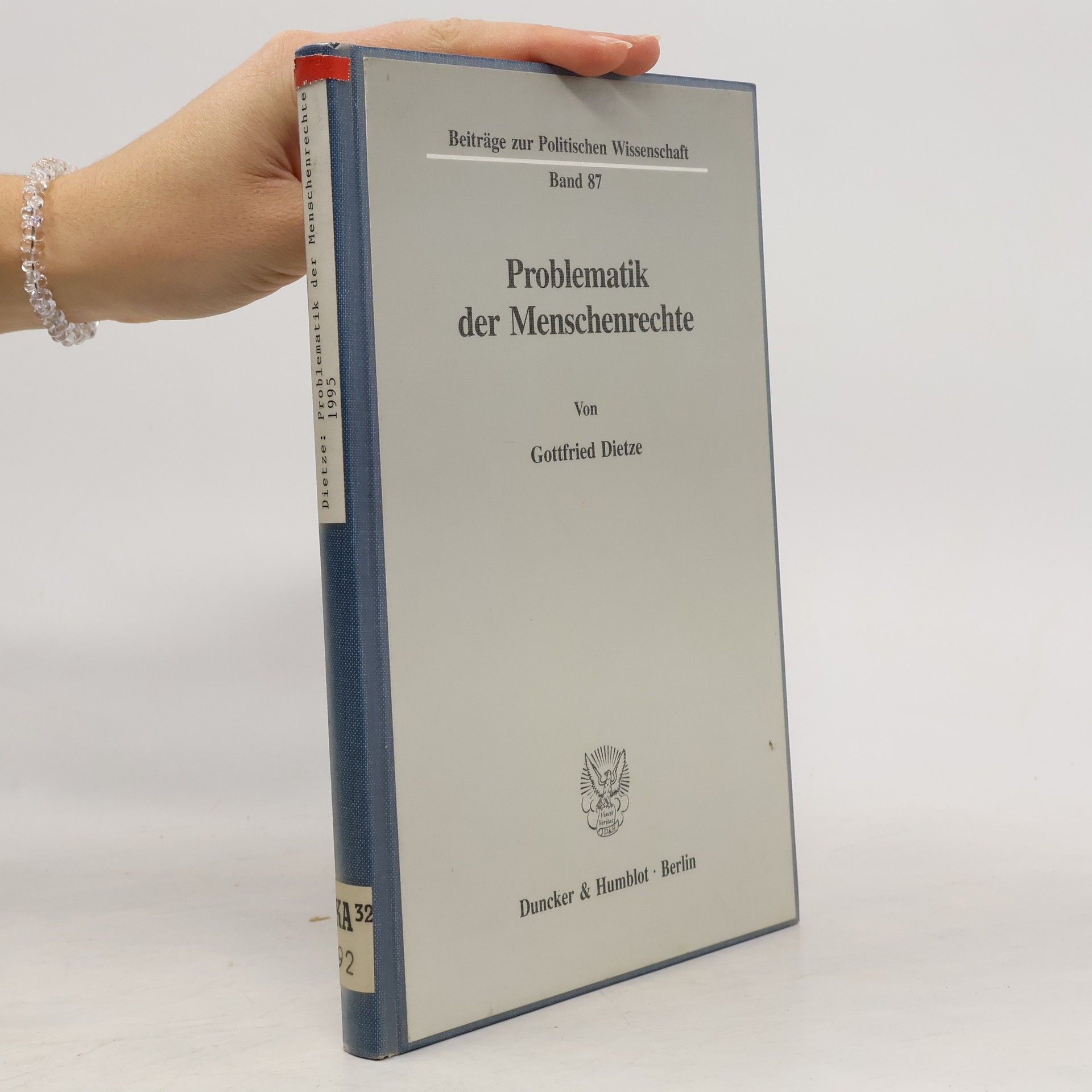
Beiträge zur Politischen Wissenschaft 87
A Classic of Federalism and Free Government
The book delves into Weber's approach, arguing for its humanizing value, which has often been overlooked by critics. It explores the humanistic mission of universities and their significance in fostering youth engagement and supporting democratic ideals. Through this examination, the author aims to highlight the essential role of education in promoting a more humane society.