physiolehrbuch Krankheitslehre. - Titel war angekündigt unter: Gynäkologisch-geburtshilfliches Kompendium für die Physiotherapeuten-Ausbildung
Wolfgang Harms Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
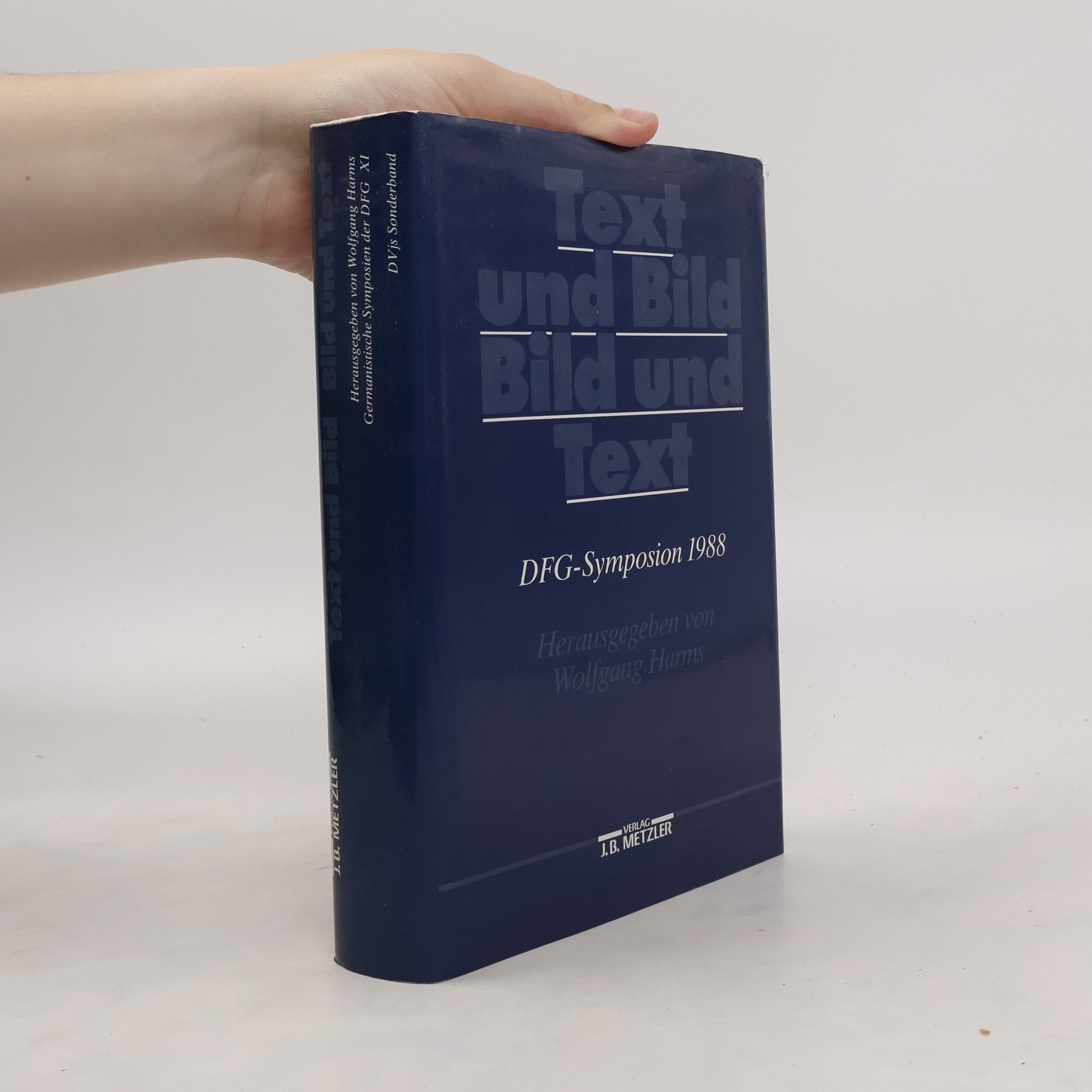


This collection features a range of scholarly essays exploring various themes in medieval literature and culture. Aaron Tietjen Wright examines the distinctiveness of Avianus and his medieval readership. Alexandra Stein addresses issues of corporeal authenticity in the context of Herzog Ernst's wondrous peoples. Simon Demmelhuber reflects on the transition from empirical phantoms to the legendary narrative of Sanct Brandan in Middle High German literature. Kelly Kucaba analyzes the courtly representations of truth in Isolde's trial by God in Gottfried von Straßburg's work. William Hutfilz discusses the self-understanding of courtly life as depicted in Gottfried's Tristan and its ties to the European bucolic tradition. Udo Friedrich investigates the interplay between nature and culture in the Strasbourg Alexander. William D. Carroll explores the perspectives of the foreigner in Thomasin von Zerclaere's Welsche Gast and Hugo von Trimberg's Der Renner. Marc Pearson delves into the theme of foreign heroism in the case of Kudrun. Herfried Vögel sketches the experience of the foreigner at court through Neidhart's songs. Christoph Kleppel considers the dynamics of letter writing in Johann Hartlieb's works. Alexander Ann Marie Rasmussen discusses the social construction of femininity in the Minnerede. Bruno Quast presents poetological reflections on the Nuremberg Fasnacht plays, while Ute von Bloh contemplates wonder and the limits of
Text und Bild, Bild und Text
- 532 Seiten
- 19 Lesestunden
Das Reisensburger Symposion behandelt in interdisziplinären Beiträgen und Diskussionen Fragen der Text-Bild-Beziehungen: kulturanthropologische und kultursoziologische Probleme, Leistungen und Grrenzen der Verbildlichung, Konkurrenz von Text und Bild, Ästhetik der Text- Bild- Beziehungen. An dem Symposion waren Vertreter der Germanistik, der Kunstgeschichte, der Volkskunde sowie der Philosophie, Romanistik, der Slawistik der Medien- und Theaterwissenschaft beteiligt.