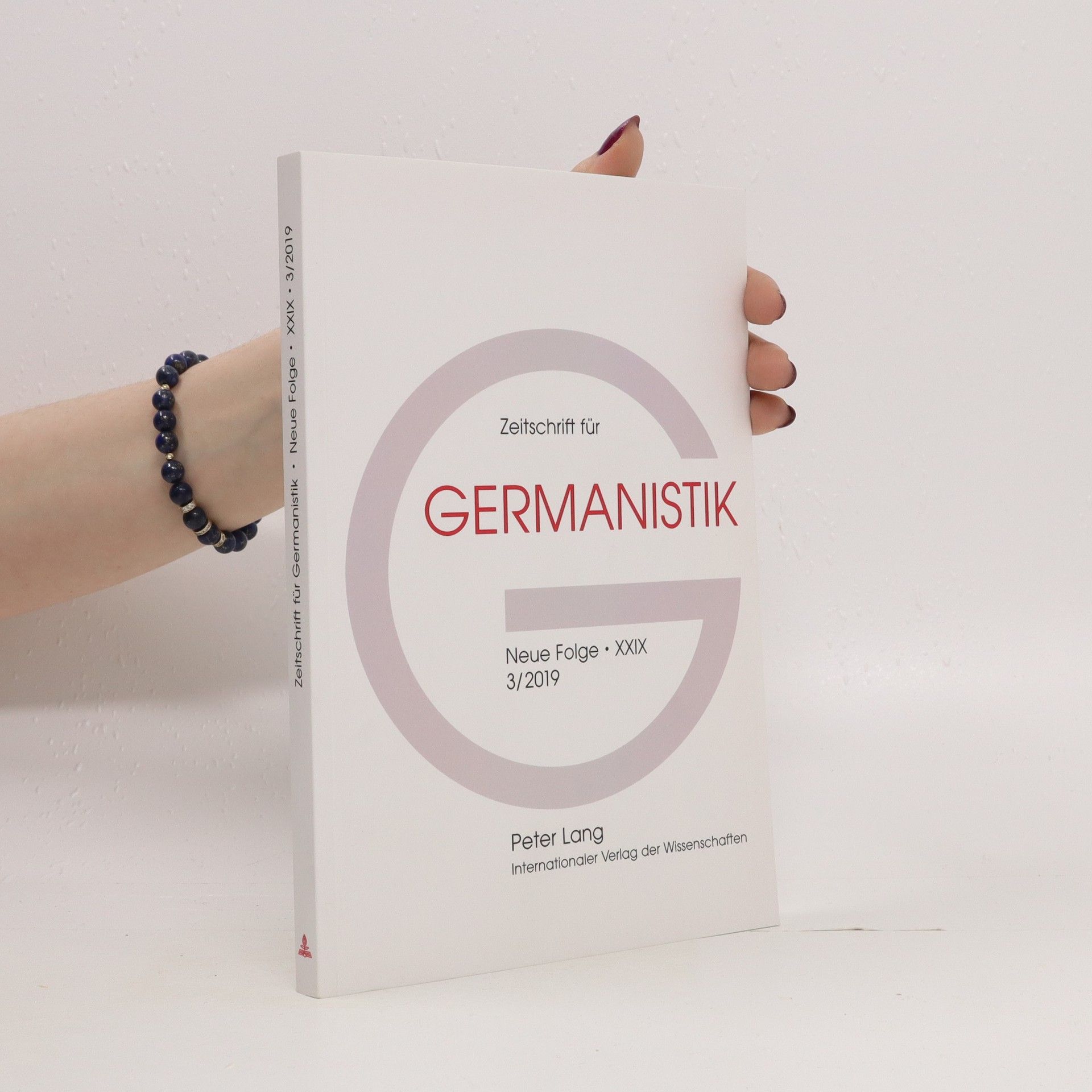Also sprach Zarathustra ist bis heute ein schwieriges, ein rätselhaftes und erstaunliches Buch. Die hier vorgelegte «lecture à plusieurs» geht von der Entfaltung der Kreativität in den Kapiteln und der Komposition des Ganzen aus. Sie gewinnt das Verständnis konkret und objektiviert es in der gemeinsamen Kritik. Damit tritt die in der Forschung eingebürgerte Dichotomie von Philosophie und Literaturwissenschaft in den Hintergrund; vor allem geht es um die beständige, philologische Reflexivität, die erst möglich macht, dass Nietzsches Denken sich entschieden sprachlich vollzieht. Die Lektüren sind nach Hauptfragen gebündelt, die das Werk aufwirft: der Lehre als Textpraxis, der Buchgenese und Werkpolitik, den Forschungstopoi, der dreifachen Vernunft von Philosophie, Poesie und Philologie, der Idiomatik, Komposition und Vielfalt an Gattungen, der Autoreflexion und dem produktiven Umgang mit den Traditionen.
Mark Georg Dehrmann Bücher